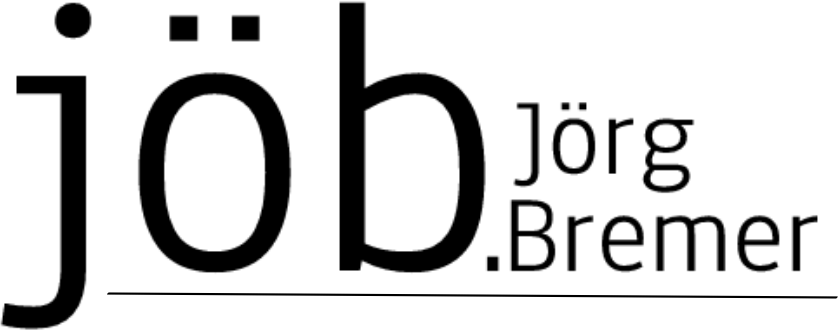Warum alles in der Welt wieder dies Jerusalem?
Wie schön es doch an diesem Abend in Rom war. Nach guter Pasta bei herrlichem Wein aus Latium nun auf der heimischen Terrasse das Gespräch mit der zufällig herbeigereisten Freundin. Mitten im alten Rom, dieser Traumstadt aller Liebesfilme zu Bella Italia: Lauer Wind, Fetzen von Akkordeon-Musik aus einer nahen Trattoria, der Tenor vom Pantheon-Platz in der Ferne und ein paar balgende Möwen über uns. Ein unbestimmter Duft aus Sommer und Blumen. Frieden! Ich hatte Henriette von der wachsenden Liebe zu diesem guten Leben in Rom berichtet. Dass ich so glücklich sei, nach 18 Jahren in Israel nun endlich hier arbeiten zu dürfen. Doch Henriette hatte den Koffer im Flur gesehen und erfahren, dass ich gleichwohl morgen wieder einmal nach Jerusalem reisen wollte. „Schon wieder? Du bist verrückt“. Ich hatte ihr zu erklären versucht, dass „beide Städte meine Städte“ sind; denn ich sei in beiden zuhause. Dass Rom und Jerusalem aber nicht nur in meinem Leben zusammen gehörten. „Das gilt allgemein. Die Ewige und die Heilige antworten durch die gesamte Geschichte aufeinander. Sie haben einiges gemeinsam; vieles trennt sie.“ Und dann hatte ich ihr gebeichtet, dass ich mich „mit dem Herzen in Jerusalem und mit dem Verstand in Rom“ sehe – „oder umgekehrt. Und darüber will ich nachdenken.“
Henriette antwortete fast barsch: „Wenn Du jetzt wieder nach Jerusalem fliegst um zu recherchieren und dafür Dein wunderbares Rom verlässt, dann solltest Du Dich an eines erinnern: Dich hat Jerusalem damals in die Depression gestürzt“, sagte die Freundin, mit der wir vor fünfzehn Jahren gemeinsam in Israel gelebt hatten, bis die UN-Mitarbeiterin nach Washington zur Weltbank weitergezogen war. Sie hatte in ihren Jerusalem-Jahren immer wieder für heitere Abende ohne politische und religiöse Debatten gesorgt, herrliche Essen sowie gute Weine. Diese Treffen waren ein guter Ausgleich zum bitteren Journalistenalltag gewesen, der um die Tragödie dieses Landstrichs kreiste: Terror in Israel, Panzerschlachten in Gaza, Enteignungen, Mauer, Verwüstungen in den Herzen auf beiden Seiten. Und ich stets dazwischen mit dem Versuch, „leidenschaftlich von beiden Seiten“ zu berichten. Henriette insistierte: „Erinnerst Du dich denn nicht mehr daran“, sagte sie nun, „wie Du schimpftest, dass da die Volksgruppen in sozialem Autismus nebeneinander her lebten? Säkulare Juden und Ultraorthodoxe, Araber neben den Juden. Palästinenser gegen Israelis. Hast Du mir damals nicht immer gesagt, Israelis und Palästinenser seien beide völlig meschugge, ein Frieden zwischen diesen Völkern kaum denkbar.“
Wie gesagt, im Flur stand der gepackte Koffer für eine Woche Jerusalem. Jedes Jahr fahre ich mindestens einmal „zurück“, aber das wollte ich Henriette jetzt lieber nicht beichten. Es war wirklich nicht leicht zu verstehen, was mich regelmäßig wieder nach Zion zog. Zwar konnte ich mich an so harsche Worte von mir nicht erinnern, aber Henriette hatte Recht. Ich hatte seit Ausbruch der zweiten Intifada im Herbst 2000 dem Frieden im Nahen Osten keine Chance mehr gegeben, und seither war alles nur noch schlimmer geworden. Die Berufsdiplomatin Henriette fasste es undiplomatisch: „Dieser Ministerpräsident Benjamin Netanjahu führt sein Volk seit einem Jahrzehnt zielgenau ins Unglück und bereitet Israels Ende vor; während die Palästinenser noch immer nicht gelernt haben, wie sie sich selbst regieren sollen.“
Ich versuchte Henriette mit dem Licht über Jerusalem milde zu stimmen, wollte von der Klarheit der Luft reden. Beinahe hätte ich vor ihr das Bekenntnis abgelegt, für mich sei in Jerusalem noch immer etwas von Jesu wundersamer Himmelfahrt spürbar. Aber ich wusste, dass ich mit Religion bei ihr nicht landen durfte. „Sieh es doch einfach, wie es ist“, befand sie. „Obwohl die Sonne herrlich hell und klar scheint, ist Jerusalem das Herz der Dunkelheit, ein pechschwarzer Platz, an dem offenbar alle Probleme dieser Welt aufeinander stoßen: religiöser Wahn, politische Dummheit, nationaler Hochmut und rückwärtsgewandte Blindheit. Lots Frau regiert das Land“, sagte Henriette und dachte an jene Frau im Alten Testament der Bibel, die nicht gottgehorsam und nach vorne sehend Sodom und Gomorra verließ sondern in die Sicherheit ihres Unglücks zurückblickte und darüber zur Salzsäure erstarrte.
„Du bist wahnsinnig“, befand Henriette noch, „Du hast Dich in die Heiterkeit Roms und seine Schönheit gerettet, um Dich nun, so als sei es ein Spiel, ins Fegefeuer Zions zu begeben.“ An diesem Abend gestand ich Henriette nicht, dass diese Reise nach Jerusalem der Auftakt für mehrere Besuche sein würde: Ich möchte nämlich ein Buch über „Rom und Jerusalem“ schreiben. Und was Henriette nicht wusste: Es gab sogar schon einen Buchtitel, der ihr Unverständnis über mein Vorhaben in Worte gefasst hatte. Die deutsch-schwedische-israelische Schriftstellerin Cordelia Edvardson – eine Freundin von uns in Jerusalem – hatte dieser unerklärlichen Neigung zum „Fegefeuer Zions“ schon vor Jahrzehnten in einem anderen Zusammenhang das Motto gegeben: „Gebranntes Kind sucht das Feuer“. Wir verabschiedeten Henriette nach Mitternacht. Sie guckte noch einmal auf den gepackten Koffer für Jerusalem im Flur und ging kopfschüttelnd.

Wie bitte? Jerusalem als Beispiel für Toleranz?
Mittlerweile bin ich in Jerusalem angekommen. Es ist früher Abend. Vom kleinen Balkon im Gästehaus des Propstes nahe der evangelisch-deutschen Erlöserkirche in der Altstadt höre ich, wie die griechisch-orthodoxen Mönche ihren Patriarchen mit dem Hammerschlagen auf schwere Bleche zum Gebet in die Anastasis, die Grabes- und Auferstehungskirche rufen. Gleichzeitig will sich offenbar jeder Muezzin in der Stadt im schrillen Abgesang der Tagessure mit seinem Nachbar-Muezzin in der nächsten Moschee überbieten. Gegenüber auf dem Dach des Schucks hasten derweilen ultraorthodoxe Juden zum Abendgebet an die „Klagemauer“, die einst in antjudäischem Eifer so genannt wird; denn in der Regel wird an der Herodianischen „Westmauer“, kurz hebräisch „Kotel“ – wie Mauer – nicht geklagt sondern gebetet, getanzt und das Judentum gefeiert. Christen, Muslime und Juden nehmen bei all dem Treiben nicht voneinander Notiz, wie schon Henriette bemerkt hatte. Sie meiden sich, laufen wie an Schnüren gezogen aneinander vorbei. Willkommen im Wahnsinn von Zion.

Mir ist dieser Wahnsinn allerdings nicht nur vertraut. Er ist für mich normal. Man kann sich geradezu auf ihn verlassen. Aber halten ihn andere, im Gegensatz zu mir, auch noch länger als etwa 20 Jahre aus? Kann man bei aktiver Teilnahme an diesem Wahnsinn, also ohne sich nur auf den eigenen Glaubensverein zu beschränken oder jenseits von allem nur Blumen oder Katzen zu züchten, über Jahrzehnte in Jerusalem/Zion/Al Quds leben, ohne von diesem Wahnsinn selbst verstört und verrückt zu werden? Der Brite Julian, ist so einer, der Jerusalem nie verlassen wollte. Er könnte es, sagt er. Der Mitfünziger, dessen Englisch dafür bürgt, dass er aus bestem Hause stammt, ist Jude. Aber er ist offen für die anderen beiden Religionen, will sie nicht nur kennen sondern auch erfahren: In unseren Jahren in Jerusalem trafen wir ihn in der Kluft eines Ultraorthodoxen zum Schabbes-Dinner genauso wie als muslimischer Beter mit Kefije, mit dem Kopftuch der muslimischen Palästinenser, auf dem Haram as-Sharif, wie die Muslime den Tempelberg nennen. Unvergessen ist auch Julians Ausmessung des Grabgebäudes über der Grablege, auf der Jesus nach der Beerdigung bis zur Auferstehung beerdigt worden sein soll. Julian ist homosexuell und verliebte sich während eines Besuches in Kairo in einen muslimischen Ägypter, der gerade zum Christentum übergetreten war. Ihn konnte Julian nach der Heirat nicht nach Jerusalem mitnehmen, er hätte dort als Ägypter nie eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen, und so zogen beide nach London. Von dort aber kommt Barnett immer wieder nach Jerusalem zurück, geradezu angezogen von dem Wahnsinn dieser Stadt.
„Ohne George, meinen Mann, hätte ich Jerusalem auch nie verlassen“, sagt Julian. Ich hatte ihn bei der Einreise am Flughafen Ben Gurion wieder getroffen, und wir hatten uns gleich für den ersten Abend in der gemeinsamen Stadt verabredet, wo er vor Jahren unsere drei Kinder in der International School unterrichtet hatte. Jetzt sitzen wir in einem Café am Damaskus-Tor „Ich habe mich in dieser heiligen Stadt nur wohl gefühlt, ich habe mich immer inspiriert gesehen. Hier braucht man durch diese geistige Aufladung der Religionen keinen Schlaf, und außerdem ist Jerusalem weniger wahnsinnig als gesegnet.“ Und dann forderte er mich auf, Jerusalem doch als Erfolgsgeschichte der Toleranz zu begreifen. Das schien mir schon ein arger Missgriff in die europäische Begriffsgeschichte zu sein, aber Julian argumentierte ziemlich sachlich und hatte sogar Zahlen parat: „Da liegen also die drei überaus zentralen Belegplätze für die drei Religionen entweder „in eins“ auf dem Tempelberg oder gerade einmal 300 Meter davon Luftlinie entfernt in der Anastasis, die gemeinhin falsch Grabeskirche genannt wird, obwohl doch Jesu Grab erkennbar lehr ist und der Christ darum von „Grabes- und Auferstehungskirche“, kurz griechisch Anastasis spricht. Trotz dieser Nähe kommt es doch relativ selten zu Blutvergießen und Todschlag“, fand Julian. Man könne geradezu von „reicher Glaubensvielfalt in einem Nest“ reden. Er habe immerhin 211 verschiedene jüdische Sekten in Jerusalem gezielt, 116 islamische Gruppierungen und 106 christlichen Denominationen – alle in dieser Kleinstadt auf dem Wüstenkamm: „Dies Jerusalem ist nicht so riesig wie London, sondern ziemlich klein, und dennoch sind sektiererische Morde nicht an der Tagesordnung. O. K!. Man bespuckt sich bisweilen, aber dann hat man einander auch schon wieder die Rücken zugekehrt.“ So verstieg sich Julian zu der These, Jerusalem könnte geradezu ein Modell dafür sein, wie die unterschiedlichsten Gruppen doch nebeneinander her leben können. Jerusalem sei nicht Opfer des Hasses sondern geradezu eine Erfolgsgeschichte der Kohabitation, fand Julian. „Man könnte geradezu sagen: Wenn man dergleichen Toleranz im kleinen, dicht besiedelten Jerusalem, an der Wiege der drei Religionen möglich ist, dann sollte man das auch andernorts hinkriegen.“
Irgendwie war ich erleichtert, dass mir Julian auf diese Art ein vernünftiges Argument dafür gab, diesen Wahnsinn von Zion als eine historisch eingeübte und offenbar auch historisch eingespielte geradezu bewährte Methode zu verstehen. Sie verlangte von mir auch nicht, mich auf diesen Wahnsinn einzulassen sondern setzte das Interesse voraus, dies Jerusalem aus einer gewissen Distanz immer wieder neu verstehen zu lernen. Diese Lehre nahm ich mit ins Hotel zurück; und jetzt, wo ich diese Zeilen schreibe, gebe ich sie an die Leser weiter, die womöglich in Harmonie und Gottesseligkeit schwelgen oder aber mit Gott und Seligkeit nichts zu tun haben wollen. Wer sich mit Jerusalem und Rom auseinandersetzen will, der kann nicht an diesen Gott vorbei sehen, der in diesen beiden Städten auf diese und auf die andere Art und Weise eine zentrale Rolle spielt. Gleichzeitig bin ich natürlich gerne bereit zuzugestehen, dass ich parteiisch bin. Ich schreibe dieses Buch als evangelischer Christ, der sowohl in Jerusalem als auch in Rom zur deutschen evangelischen Gemeinde gehört.
Diese Zugehörigkeit macht freilich nicht nur parteiisch; sie schafft auch eine besondere Perspektive: In unseren 18 Jahren Jerusalem gehörten wir zu einer Minifraktion innerhalb der ohnedies schon kleinen christlichen Gemeinschaft; aber obwohl wir so quasi an der Peripherie des Glaubenskonflikts standen, gingen doch von der evangelisch-deutschen Gemeinde in der Erlöserkirche wichtige ökumenische Impulse aus. Diese deutsche Gemeinde hatte ein Alleinstellungsmerkmal, das ihr frühere Propst Karl-Heinz Ronecker einmal so beschrieb: „Unsere Gemeinde lebt mit ihrer deutschen Geschichte im jüdischen Teil und zugleich inmitten der meist Israel feindlichen muslimischen Gesellschaft Jerusalems; mithin sitzen wir immer zwischen beiden Stühlen. Das ist ungemütlich und darum eine Bereicherung. Ein Ansporn, Brücken zu bauen“. In Rom dagegen kennen die meisten die evangelisch deutsche Gemeinde gar nicht. Viele Italiener hegen gewiss auch Zweifel daran, ob Evangelische überhaupt an Jesus Christus glauben. Aber im Konzert der sich um den Vatikan kreisenden christlichen Denominationen spielt diese evangelisch deutsche Gemeinde immer eine besondere Rolle. Bei ihr waren die letzten drei Päpste zu Gast; der deutschen Gemeinde gab Papst Franziskus einen Abendmahlskelch, um „so bald wie möglich“ zu einer gemeinsamen Eucharistie zwischen evangelischen und katholischen Christen zu kommen. Aber davon später!