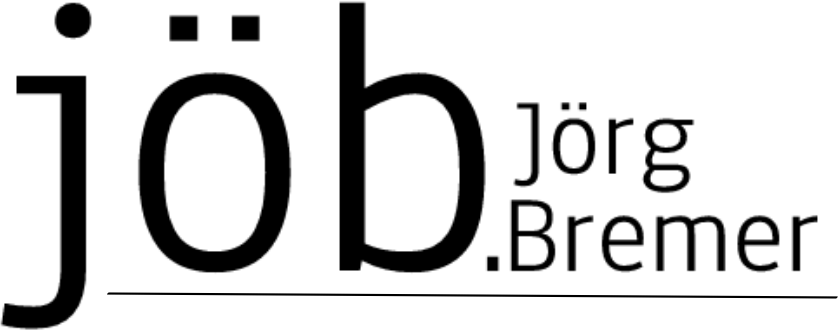Folco Terzani liebt das einfache Leben. Barfuß und ohne Handy hat er sich das Paradies des berühmten Vaters zu eigen gemacht. Von Jörg Bremer

ORSIGNA, im Dezember. Folco Terzani nimmt seinen Gast in die Arme wie einen alten Freund, dabei sieht man sich zum ersten Mal. Was für ein warmherziges Willkommen in kalter Umgebung!
Hier auf dem Bahnsteig in Pracchia, 600 Meter über Pistoia in der Toskana gelegen, sind es gerade einmal null Grad, und es liegt Schnee. Zudem ist es schon dunkel und der Bahnhof kaum erleuchtet. Aber was soll’s: Folco Terzani trägt keine Schuhe, sondern ist barfuß unterwegs. Nackt ragen die Füße aus der langen Hose hervor. In den Bergen lebt er stets ohne Schuhe und Strümpfe: „Ich mach’s wie der heilige Franziskus.“
Mit dem Auto geht es noch ein paar Kilometer höher, in den Weiler Orsigna. Die Einfahrt zum Haus ist eingeschneit. Folco Terzani steigt leichtfüßig durch den vereisten Schnee. Gästen trägt er auf: „Bringt festes Schuhwerk mit!“
Hier oben lebte schon sein Vater, Tiziano Terzano, der 2004 im Alter von 66 Jahren starb. Folco Terzani, 1969 in New York geboren, Autor und Dokumentarfilmer, hat sich das Paradies des Vaters zu eigen gemacht. In Orsigna erlaubt er sich das einfache Leben, kleidet sich in lumpige Pullover und Hosen, trägt die Haare schulterlang, als könnte er sich einen Friseur nicht leisten. Terzani sucht mit bloßem Fuß festen Tritt. Er will Teil der Natur sein und lieber auf den Wind hören als auf das Fiepen eines Handys – was er darum natürlich auch gar nicht besitzt.
Nicht Armut macht aus ihm den Eremit. Folco Terzani ist gleich in mehrfacher Hinsicht wohlhabend. So hat er viel vom Vater Tiziano gelernt, den Italien mehr als ein Jahrzehnt nach seinem Tod noch immer als einen seiner bedeutendsten Reporter ansieht und der in Deutschland als Fernost-Reporter für den „Spiegel“ bekannt wurde. Folco ist auch reich, weil er sich in Absetzung vom Vater einen eigenen Schatz an Weisheit erworben hat. Und er ist wohlhabend, weil er von den Tantiemen der Werke seines Vaters und der eigenen leben kann. Das alles schafft unschätzbare Unabhängigkeit.
Wenn man mit Folco Terzani zusammensitzt, ist sein Vater, zärtlich „Babbo“ gerufen, ständig präsent. Die Möbel und Teppiche erinnern an ihn. Am Tisch sitzt auf einem Hocker auch Babbos Frau, Folcos Mutter. Angela Staude aus dem Hamburger Großbürgertum, selbst Autorin, war die große Stütze ihres Manns. Sie teilte mit dem Sohn aus armem Hause in Florenz all sein Hoffen auf den Kommunismus. Sie bestärkte ihn auf seinem Berufsweg durch entlegene und gefährliche Orte Ostasiens und ließ ihm die Freiheit, seine Neugier zu stillen, während sie seine Texte aufbereitete. Angela Staude war der Fixpunkt, als sich der Sterbenskranke in Orsigna darauf vorbereitete, „seinen Körper zu verlassen“. Seither bewacht sie sein geistiges Erbe – und das Haus mit der Hütte, in der er sich zum Schluss wie ein Sadhu niederlegte, um den Tod als „größten Guru“ zu empfangen.
Angela Staudes strahlende Augen schauen bewundernd auf ihren Sohn und scheinen nach dem zu suchen, was vom Vater im Sohn steckt. Gemeinsam ist ihnen das Buch, das im Frühsommer 2004 im Garten vor dem Haus entstand: der Weltbestseller „Das Ende ist mein Anfang“. Monate vor dem Tod war der Vater auf Folcos Bitte eingegangen, ihn noch einmal fragen zu dürfen, „was er immer schon fragen wollte“. Daraufhin erzählte der Vater dem Sohn, was ihm wichtig war. Und dass er nach seinem erfüllten Leben so satt sei, dass ihm „der Tod als Fest eines guten Lebens“ erschien, wie sich Folco erinnert. Der Sohn hörte nur zu und schnitt das Gespräch im Buch als Denkmal für seinen Babbo so gut zusammen, dass auch er weltbekannt wurde – spätestens seit der Verfilmung des Buchs mit Bruno Ganz und Elio Germano in den Hauptrollen.
Hätte der Sohn den Vater kritisch befragt, wäre vielleicht noch am Lebensende des Alten ein Generationenkonflikt ausgebrochen. Denn so nah sich Vater und Sohn auch durch ihre fernöstlichen Prägungen sind, sie unterscheiden sich stark: „Mein Vater wollte das Leben der anderen nur probieren, reiste, betrachtete und schrieb auf“, sagt Folco. „Ich aber will Teil sein und miterleben.“ Sein Vater selbst habe ihn auf dieses Gleis gesetzt. Er steckte nämlich den elf Jahre alten Sohn und die noch jüngere Schwester Saskia in eine rotchinesische Grundschule, nachdem die Familie in Peking angekommen war. Das sei die schlimmste Zeit seines Lebens gewesen, erinnert sich Folco, aber im Rückblick auch eine wichtige Erfahrung. Während andere Ausländer ihre Kinder in internationale Schulen schickten, sollten sie lernen, wie das Land funktioniert, also zum Beispiel auch das Bespitzeln. Statt Bällen mussten sie Handgranaten-Attrappen werfen. Erst nach Monaten hätten sich die Eltern erweichen lassen und ihn von dieser Schule genommen. Seither war sich Folco zweier Dinge bewusst: Der Ferne Osten war ihm nicht mehr fremd. Und er war für immer immun gegen jede Ideologie.
Den Vater hingegen hatte seit der Jugend der Kommunismus geprägt. Es habe ihn zu Tränen gerührt, als die nordvietnamesischen Truppen des Vietkong im Frühling 1975 Saigon eroberten und Süd-Vietnam vom „amerikanischen Imperialismus und Kapitalismus“ befreiten. Den Sieg der Kleinen über die Großen habe der Vater wie den Höhepunkt seines Lebens gefeiert. Umso grauenvoller sei für ihn die Enttäuschung über die Verkrustungen in der regierenden KP Chinas gewesen und über die Greueltaten von Diktator Pol Pot in Kambodscha. Erst danach war für ihn der Kommunismus als Lösung für die Probleme der Menschheit gescheitert. Revolutionen gebe es nur in einem selbst, sagte der Vater.
In Tokio wiederum erlebte er von 1985 an ein Land, „in dem nur Konformität, Ehrgeiz und Materialismus herrschten“. Seitdem enttäuschte ihn die Politik „als Instrument der Veränderung“ generell. In Wahrheit könne man gegen die menschliche Natur herzlich wenig tun. Der Mensch sei Individualist, Egoist und könne sich nur von sich aus ändern, resümierte der Vater.
Diese Erkenntnis des Alten nahm sich der Sohn schon mit 27 Jahren zu Herzen – wenn auch aus Not. Nach dem Studium der Philosophie und Literatur in Cambridge und einem Abschluss an der Filmschule in New York sei er ganz „preppy“ gewesen, gut rasiert und mit Button-Down-Hemd, aber todunglücklich. „Ich wusste nichts mit meinem Leben anzufangen.“ Da habe sein Vater erzählt, wie beeindruckt er von Mutter Teresa gewesen sei, „und er war selten beeindruckt“. Sofort brach der Sohn dorthin auf. „Doch statt wie mein Vater nach zwei Tagen wieder abzureisen, blieb ich.“ In einer Welt der Individualisten und Egoisten habe er in Mutter Teresa eine Person kennengelernt, die ihn mehr als jede Politik und jede Theorie überzeugte, sagt Folco. „Sie lebte den heiligen Franziskus nach. Sie liebte: Wenn da eine Person auf der Straße lag, arm und sterbend, dann hob Teresa sie auf, gab ihr ein Bett und pflegte sie.“ Die Monate im Haus „einer franziskanischen Heiligen“ wurden zum prägenden Kapitel seines Lebens.
Kurz vor Mutter Teresas Tod drehte er 1997 zusammen mit seiner späteren Frau Ana, die er im Volontariat kennengelernt hatte, einen Dokumentarfilm über die Ordensschwester. Und er begann sich für die Inder und ihre Religionen zu interessieren. 1999 zog sein Vater nach. Schon krebskrank, entsagte er der westlichen Medizin, zog in den indischen Himalaja und ließ sich in einem buddhistischen Kloster nieder. Damit probierte er nicht mehr nur aus, sondern wechselte erstmals in eine Welt, die er bisher nur beschrieben hatte, erzählt Folco. Zwar suchte auch Folco Kontakt zu heiligen Sadhus und weisen Gurus. Doch er schloss sich nicht auf Dauer an, sondern nahm seine Ana mit nach Los Angeles, wo er seinen ersten Sohn bekam: Novalis.
In Orsigna endet der Abend bei Mutter und Sohn früh. Der Wecker klingelt, wenn die Sonne aufgeht. Kaum ist sie über den Berg und erhellt das Zimmer, klopft Folco an, nur mit orangefarbenem Lendentuch und einem über die Schulter geworfenen Wollplaid bekleidet, natürlich barfuß, trotz der Eiseskälte.
„Komm zum Tipi“, sagt er, „wir feiern das Licht.“ Das Tipi ist ein kanadischer Wigwam, den ein Freund und Nachbar errichtet hat, der mit seiner Frau aus Kanada kam. In der Mitte des Tipis lodert eine Flamme. Viel Asche liegt drum herum. Folco nimmt den Sitz der Yogi ein und bestreicht seine Haut wie ein Sadhu in Indien mit Asche. So würde er am liebsten jeden Tag beginnen, sagt er. „Erleben, wie die Sonne ihre Macht zeigt. Dies Feuer hier sehe ich dabei als ihren Anwalt auf Erden.“ Die Flamme erschaffe die feine tote Asche, die uns reinigen könne und uns zugleich ans Ende erinnere. Immerhin gibt es heißen Tee, und der Feuerqualm beißt nur manchmal in die Augen.
Seine beiden jungen Söhne Cosimo und Florian aus zweiter Ehe schlössen sich gerne diesen west-östlichen Morgenstunden im Wigwam an, sagt er, und liefen hier auch stets barfuß herum. Leider seien sie wegen der Schule meist mit der Mutter in Florenz. „Auf eine bestimmte Art setzen sich Väter wohl immer in ihren Söhnen fort.“ Er sei ihnen aber kein intellektueller Wegbereiter wie der Vater, wolle ihnen auch nichts über Ideologien, Politik und über bestimmte Religionen beibringen. Er spreche mit ihnen vielmehr über die Sadhus in Indien wie über Franziskus von Assisi und wolle vorleben, wie sich der Mensch in die Schöpfung einordnen könne und pfleglich mit ihr umgehen müsse. Franziskus habe sogar mit den Tieren gesprochen.
Dieser Tage hat Folco Terzani die Erzählung „Der Hund, der Wolf und Gott“ herausgebracht, die von einem Haushund erzählt, der von seinem Herren ausgesetzt wird und nun allein durchkommen muss. Der kluge Wolf nimmt ihn in sein Rudel auf und wird sein Lehrmeister. Der Haushund wird darüber wieder zum wilden Tier. Und weil er nun seiner Natur gemäß lebt, findet er auch den Weg zu Gott. Im Leben seiner Kinder möchte Folco Terzani ein bisschen dieser weise Wolf sein. „Guck dir doch an, wie weit es mit uns Menschen gekommen ist“, sagt er und legt Blüten auf den Rand der Feuerstelle: „Wir sind zu Monstern in dieser Schöpfung geworden, vor denen sich alle Tiere fürchten, selbst der starke Tiger.“
Nach dem Duschen und dem Frühstück bei seiner Mutter geht er spazieren, barfuß natürlich, im gleißenden Schnee zu den letzten Schäfern von Orsigna.
Artikel auch in der F.A.Z. - DEUTSCHLAND UND DIE WELT


jöb.