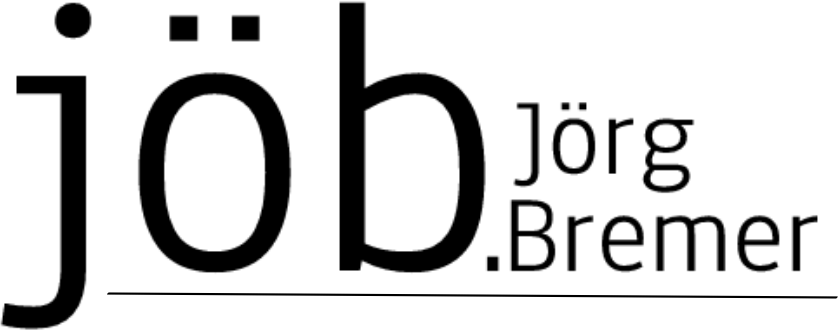(Lesezeit 8 Minuten) Papst Franziskus will aus dem Lande der Reformation einen soliden theologischen Weg zu einer gemeinsamen Eucharistiefeier für Lutheraner und Katholiken – fürs erste zumindest in konfessionsverbindenden Ehen. Nach zehn Jahren Luther-Dekade und einem abschließenden intensiven, gemeinsamen Christus-Jahr, bei dem nicht zuletzt bei päpstlichen Tagungen in Rom neue Schritte zu mehr Gemeinsamkeit zwischen Katholiken und Lutheranern gefunden wurden, hatte der Papst gehofft, er werde in der Deutschen Bischofskonferenz Geistliche finden, die sich gewissenhaft mit diesem Thema befassen und Brücken bauen. Stattdessen musste der Papst für diesen Donnerstag deutsche Bischöfe nach Rom rufen, um zunächst einen mehr persönlich geprägten Streit zwischen diesen Mitgliedern der Bischofskonferenz zu schlichten.
Der Betrachter von außen kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass weder vermeintliche Befürworter noch Gegner der gemeinsamen Eucharistie ernsthaft an mehr Einheit in Jesu Christi interessiert sind. Kardinal Marx, der im Februar 2017 mit dem Vorsitzenden der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) Bedford-Strohm vom Papst den Auftrag erhalten hatte, katholische Tradition und Lehre nach Wegen zu mehr Einheit zu durchleuchten, bereitete nämlich eine Handreichung vor, die in ihrer Oberflächlichkeit dazu einlud, seine Kritiker auf den Plan zu rufen. Diese siebenköpfige Minderheit wird vom Marx-Hauptrivalen – vom Kölner Erzbischof Kardinal Rainer Maria Woelki angeführt. Außer ihm lehnen der Erzbischof von Bamberg, Ludwig Schick, sowie die Bischöfe Rudolf Voderholzer (Regensburg), Konrad Zdarsa (Augsburg), Gregor Maria Hanke (Eichstätt), Wolfgang Ipolt (Görlitz) und Stefan Oster (Passau) die Handreichung ab.
Diese Sieben sehen in dem Text, der noch nicht einmal endgültig verabschiedet sondern für Änderungen noch offen war, eine Kompetenzüberschreitung der Bischofskonferenz; denn er verstoße gegen die Einheit der Kirche und stelle die einheitliche katholische Glaubenslehre in Frage. So wandten sie sich in einem mit der Mehrheit nicht abgesprochenen Brief an den Papst bzw. an den Ökumene-Rat der Kurie unter Kardinal Koch und sandten von ihrem Brief auch eine Kopie an den Chef der Glaubenskongregation, an den Obersten des Päpstlichen Justizrats und den Apostolischen Nuntius in Berlin. Marx wurde nur im Nachhinein in Kenntnis gesetzt. Dieser Weg an sich schon ist sonderbar; denn natürlich wissen diese sieben Bischöfe, dass der Papst genauso wie Koch mehr Ökumene zwischen Lutheranern und Katholiken will. Sie können also vom Papst nicht erwarten, dass er ihre Kritik teilt; wohl aber können sie über diesen Brief versuchen, interne Querelen in der Deutschen Bischofskonferenz zu vertiefen und so von einer wichtigen Frage der Ökumene abzulenken.
Den sieben geht es nach einem Kommentar aus dem Kölner Erzbistum vermeintlich darum, „in einer so zentralen Frage des Glaubens und der Einheit der Kirche […], nationale Sonderwege zu vermeiden und in einem ökumenischen Gespräch zu einer weltweit einheitlichen und tragfähigen Lösung zu kommen“. Das klingt so, als wüssten die sieben nicht, dass es seit 1998 in England, Wales und Schottland, seit 1999 in Kanada, seit 2000 in Indien und Südafrika Umsetzungen des Kirchenrechtes in die nämliche Richtung gibt; keiner dieser Bischofskonferenzen musste sich dem Vernehmen nach wegen ihres „nationalen Sonderwegs“ verteidigen.
Wohl aber ging es diesen Bischofskonferenzen vor allem um die Frage, ob der Ausschluss des evangelischen Ehepartners von der Kommunion eine „geistliche Notlage“ sei und um die Auslegung des Kirchenrechts. Etwa zehn Jahre später reicht es dem Papst aber nicht mehr, allein über „Notlage“ und Kirchenrecht Sonderwege in exklusiven Einzelfällen zu einer gemeinsamen Eucharistie zu bahnen. Dass der Papst mehr will, hängt nicht mit eher politischen Argumenten zusammen, wonach die Kirche irrelevant würde, wenn sie immer mehr Katholiken vor den Kopf stoße. Tatsächlich drohen jetzt gerade fromme Katholiken aus betroffenen Ehen mit dem Austritt, weil sie ihre Anliegen nicht ernst genommen sehen. Es soll auch nicht aus Bequemlichkeit ein Weg zu mehr Eucharistie gefunden werden; nach dem Motto: Hauptsache die Leute bleiben. Unser Glaube ist eh beliebig. Auch der Hinweis darauf, dass in anderen Weltgegenden Menschen für ihren Christusglauben den Märtyrertod erleiden, während sich der Westen mit „Luxus-Theologie“ befasse, dürfte den Papst nicht dazu bewegt haben, von den deutschen Bischöfen mehr zu verlangen.
Gerade im letzten Jahr, in dem Lutheraner und Katholiken auch in Rom gemeinsam das Christus-Jahr feierten und dafür eine erste gemeinsame Liturgie der Schuld und Sühne einsetzten, wurde bei Konferenzen deutlich, dass es letztlich zwischen Lutheranern und Katholiken keine theologischen Barrieren gibt, wenn man die katholische Lehre und ihre Tradition ernst nimmt, so wie es eben auch Martin Luther tat. Gewiss, allein der Besuch und das Geschenk eines Abendmahlskelches an die deutsche lutherische Gemeinde in der Christuskirche von Rom, hätte papsttreue Katholiken dazu bringen müssen, Franziskus zu folgen und infolge dieser Veranstaltung stets diesen Kelch mit Lutheranern zu teilen. Damals sagte der Papst in der Christuskirche: „Das Leben ist größer als Erklärungen und Deutungen. Nehmt immer auf die Taufe Bezug: „Ein Glaube, eine Taufe, ein Herr“, sagt uns Paulus, und von daher zieht die Schlussfolgerungen. Ich werde nie wagen, Erlaubnis zu geben, dies zu tun, denn es ist nicht meine Kompetenz. Eine Taufe, ein Herr, ein Glaube. Sprecht mit dem Herrn und geht voran. Ich wage nicht mehr zu sagen.“ Das war im November 2015.
Zwei Jahre später hielten das Möhler-Institut aus Paderborn und die Jesuitenhochschule der Gregoriana in Rom eine theologische Konferenz zum Erbe Martin Luthers ab. Sie drangen dabei in die Tiefen der gemeinsamen Theologie vor, was hier nicht nachgezeichnet werden kann. Die deutschen Bischöfe aber hätte interessieren müssen, dass es keinen Unterschied beim Eucharistie-Verständnis zwischen Lutheranern und Katholiken gibt. Auch das unterschiedliche Amtsverständnis müsse nicht trennen, hieß es an der Gregoriana damals, wenn man nicht nur an die personelle Sukzession denke sondern an die Weitergabe des Glaubens und seine Lehre vom einen zum nächsten Amtsträger, vom Bischof zu seinem Priester. Das „gemeinsame Priestertum der Gläubigen und das Priestertum des Dienstes“ schlössen sich nicht gegenseitig aus.
Bei einer ebenso wichtigen Konferenz bei der Päpstlichen Historischen Kommission stellten katholische Wissenschaftler heraus, dass in vielerlei Hinsicht die einst von Luther zu Recht an Rom gestellten Fragen bis heute nicht beantwortet seien. Die Wissenschaftler hoben darauf ab, dass weniger Theologie als politischer Unwille bzw. später auch die Intoleranz beider Seiten zum Schisma führten. Schließlich wurde darauf hingewiesen, dass man viele Beschlüsse des gegenreformatorischen Konzils von Trient auch als stillschweigende Billigung der lutherischen Theologie lesen könnte, wenn man nur die Texte genauer studiere. Endlich also war es 2017 zu theologischen und historischen Konferenzen gekommen, die trennenden Schutt beiseite räumten. Aber die Neigung davon Kenntnis zu nehmen, war nicht nur bei den katholischen Oberhirten in Deutschland gering. In der evangelischen Kirche haben viele davor Angst, die Lutheraner könnten nun zu „Papisten“ werden.
Aber wie auch immer: Mittlerweile wird Martin Luther im Vatikan ernst genommen. Und das nicht nur mit einer Briefmarke. Ich traf Beichtväter im Petersdom, die den Katechismus des Reformators studieren. Er sei erstaunt, wie ernst Martin Luther die Jungfrau Maria genommen habe. „Was für wunderbare Marien-Texte Luthers“. Gleichzeitig konnte man freilich in Rom auch hören, dass es nicht so aussehen dürfe, als käme nun – zum Beispiel bei einer gemeinsamen Eucharistie – allein die katholische Kirche den Lutheranern entgegen. „Beide Kirchen müssen gemeinsam gehen“. Papst Franziskus will genau diesen „Cammino insieme“. Getreu seinem Namensvetter Franz von Assisi will dieser Papst zudem die evangelische Tradition seiner Kirche ins Zentrum rücken; die frohe Botschaft der Anteilnahme an der Auferstehung Jesu Christi. Aber die Gegnerschaft derjenigen ist groß, die aus Bequemlichkeit alles beim alten bleiben und auf den Sankt Nimmerleinstag warten wollen. jöb.