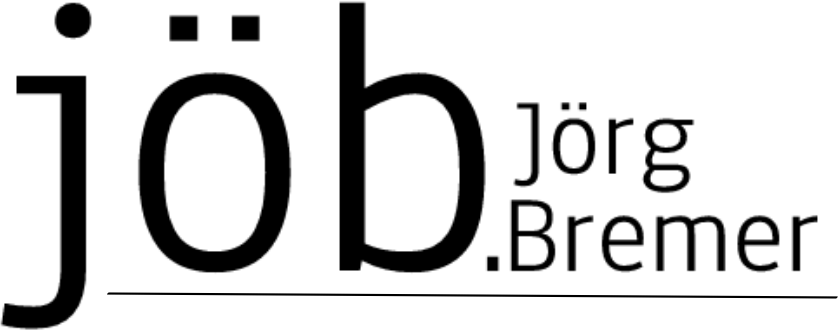(Lesezeit 5 Minuten) Heute wollen wir im Öffentlichen Leben allem den “richtigen” Namen geben. Er darf nicht rassistisch sein oder antisemitisch; nicht undemokratisch oder menschlich verletztend. Wenn wir so unsere Zukunft gestalten, ist das ja auch gut so. Aber selbst die Vergangenheit wollen viele von uns in diesem Sinne “umgestalten”: Denkmale sollen abgebaut und Straßen umbenannt werden. Für mich wirkt das wie bei dem Kleinkind, dem man die Augen zuhält. Dann sagt es. “Papi, jetzt bist Du weg.” Nein, Papi ist nicht weg; er macht das Kind nur blind. Nichts ist weg; es wird nur ausgeblendet. Diese Blindheit führt zu einer allgemeinen Geschichtsvergessenheit; denn unsere – teilweise auch rassischte deutsche – Geschichte bleibt doch dieselbe, selbst wenn wir sie “umgestalten” und ungeschehen machen wollten. Sie hat uns zum Teil tief geprägt; und gerade deswegen müssen wir uns mit ihr auseinandersetzen und sie nicht einfach wegretuschieren. Mit neuen Etiketten oder anderen Denkmälern lügt man sich nämlich nur der Geschichte heraus. Es ist billig, Bismarck abzubauen und die Berliner “Mohrenstraße” irgendwie umzutaufen, und morgen werden wir völlig vergessen haben, wer Bismarck war und in wie vielen von uns ein kleiner Bismarck verborgen ist. Auseinandersetzung heißt freilich Bildung.
Ein gebildeter Umgang mit der eigenen Geschichte kann meines Erachtens zum Beispiel in den USA nicht heißen, die Generäle der Konföderierten wegen ihres Sklavenhandels und Rassismus` von den Sockeln zu holen und in die Hafenbecken zu werfen. Erziehung und Bildung sollten eher dazu führen, sich diese Leute näher anzuschauen und auch zu begreifen, warum sie und wann sie Denkmale erhielten. Jedes Denkmal hat mindestens zwei Geschichten: Es erzählt zum einen von der Person, die abgebildet wurde und berichtet zum anderen von denen, die das Denkmal aufstellten. Es gab viele Persönlichkeiten in der Geschichte, die hätten nie die Aufstellung ihres eigenen Denkmals gebilligt. Das lehrt uns, dass Geschichte den Diskurs verlangt. Im selben Maße, in dem man zum Beispiel über die eigene Geschichte als „Faktensammlung“ lernt, muss man auch lernen, diese vermeintlichen Fakten zu diskutieren und zu bewerten; denn es gibt keine stromlinienförmige oder gar objektive Geschichte.
Ich habe darum auch kein Verständnis dafür gehabt, dass die Statuen von Lenin oder gar Stalin nach 1990 in Ost-Deutschland verschwanden. Eine Art Quittung für dergleichen serviert uns Putin gerade: Weil seit Chruschtschow – und seiner Rede vor dem KPdSU-Parteitag 1956 – die Erinnerung an Stalin ausgelöscht wurde, kann Putin heute fast zwei Generationen später auf seither blank gewordenen Geschichtsseiten seine revisionistische Stalin-Rettung schreiben. Die Fakten sind vergessen. Putin kann fakes erfinden. Die Russen lassen das geschehen. Sie wissen es nicht besser. „Und die Stirn hat keine einzige Falte“, würde Bertold Brecht den Lao Tse auf der Flucht über den ungebildeten und kenntnislosen Grenzsoldaten sagen lassen. Das heit für uns: Wir sollten Falten und damit Kenntnisse sammeln, um besser urteilen zu können. Lieber ein Denkmal zu dem Massenmörder Stalin – als ihn in die Vergessenheit zu werfen, was neue Stalins gerne hätten.
2017 noch gab es in Deutschland eine Debatte, ob das berühmte Lenindenkmal auf dem „Wiener Platz“ am Bahnhof von Dresden, das 1974 aufgestellt und 1991 an einen Steinmetz in Gundelfingen an der Donau verschenkt worden war, wieder zurückkommen könnte. Aber es gab dazu weder den politischen Willen noch die nötigen Mittel. Ich hätte dafür auch kein Geld gehabt, aber warum eigentlich nicht?
Die Geschichte der Denkmale und Straßennamen ist oft eine Geschichte der Sieger. So kamen Bismarck und Churchill zu ihren Denkmalen. Ihre Geschichte sollten wir zur Kenntnis nehmen und zunächst einmal akzeptieren. Stattdessen möchten wir nun neue Siege gegen ihre alten setzen. Heute wollen wir über General Lee triumphieren, der im Unabhängigkeitskrieg ein siegreicher General der Konföderierten war. Noch einmal: Rissen wir Bismarck, Churchill und Lee ab, würden unsere Enkelkinder deren Beiträge zur Geschichte gar nicht mehr vor Augen geführt werden. Sie würden über diese Leute noch weniger lernen als ohnehin schon. Und dann könnte ein anderer Putin – ungehindert – Fake-Geschichte erfinden.
In Jerusalem erinnerst Du Dich vielleicht an ein Denkmal, das ein gutes Gegenbeispiel sein könnte. An der Nordmauer der Altstadt ganz im Osten, bevor es runter ins Kidron-Tal geht – übrigens auf der Stelle, an der die Kreuzfahrer ihren größten (völlig weggeräumten) Friedhof hatten – steht ein jordanisches Denkmal, mit dem das Königreich an den Sieg über Israel 1948 erinnert. Das hätten die Israelis mittels der bekannten Logik nach ihrer Eroberung der gesamten Stadt 1967 abräumen müssen. Aber es steht eben da; weil es nun einmal diesen Sieg im Unabhängigkeitskrieg Israels gab. Und es tut nicht nur niemandem weh – es erklärt Geschichte und zeigt israelische Weisheit.
In Berlin wird gerade die Debatte um die U-Bahn-Station Mohrenstraße geführt. So richtig weiß man nicht, wie es zu dem Namen dieser Straße gekommen ist. Es gibt mehrere Erklärungen. Da soll zum Beispiel der Markgraf von Schwedt-Brandenburg (1669-1711) einen Mohren in seinen Diensten gehabt haben, der sich nach Dienstende in dieser Straße ein Haus bauen durfte. Eine andere Möglichkeit wäre, dass die Straße nach den Mohren benannt ist, die Friedrich Wilhelm I. von den Holländern erhalten und in der Nachbarschaft einquartiert hatte. Da jener Kurfürst 1713 gekrönt wurde und danach „die Anschaffung von 150 Mohren“ in Rede kam, könnte die Namensgebung auf jene Zeit zurückgeführt werden. Tatsächlich aber heißt die Straße schon seit 1707 Mohrenstraße. Aus dem Jahre 1680 datiert die Geschichte von Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg, der seinen Kapitän Bartelsen beauftragte, „Sclaven von 14, 15 und 16 Jahren, die schön und wohlgestalt seyn“ nach Berlin zu bringen. Gab es darunter Schwarze, die in der Friedrichstadt angesiedelt wurden? Wir wissen es nicht.
Aber es ging in jedem Fall um die Attraktion schwarzer Mitbürger in der Stadt. Dieser Umstand wäre es wert, in kleinen Plaketten unter jedem der Straßenschilder erklärt zu werden: sie sind ein spannender Teil der Berliner Sozial- und Stadtgeschichte. Plump dagegen wäre es, wegen des „Rassismus“ unserer Vorväter Straße und U-Bahn-Station umbenennen? Mutmaßlich wäre das in Bezug auf die U-Bahn-Station übrigens schon geschehen, wenn nicht der andere mögliche Name Michail Glinka wäre. Seine Straße kreuzt an der U-Bahn-Station die Mohrenstraße. „Zum Glück“ ist dieser russische Komponist Antisemit gewesen. Die DDR benannte jene Straße 1951 nach ihm; vorher hieß sie seit 1700 Kanonier-Straße. Der Senat hat sich Bedenkzeit ausbedungen. Bürgerinitiativen beginnen zu agieren.
Wenn wir heute Denkmale abreißen und Straßennamen ändern; dann geschieht das oft aus einem Affekt, aus Wut oder Unkenntnis. Oder aus der irrigen Vorstellung, wir könnten den Rassismus oder Antisemitismus unserer Vorväter ungeschehen machen. Als hätte es ihn dann nicht gegeben. Das wäre nur ein Leugnen, ohne sich weiter mit der Sache zu befassen. Wenn man wirklich ein Interesse daran hat, seine Gesellschaft von Rassismus und Antisemitismus zu befreien; dann sind diese Namen genau jene Reibungspunkte, die genauso wirken könnten wie das Stelen-Denkmal für die sechs Millionen Opfer der Shoah. Oder wie die Stolpersteine für jüdische Mitbürger, die deportiert und in Auschwitz umgebracht wurden. Sie haben ihren Nutzen. Die Mohrenstraße solltem nicht umbenannt werden. (jöb.)