Ob Christ oder Muslim, ob Hindu oder Atheist – der Personal Trainer (PT) erfüllt einen wichtigen Auftrag für die ganzheitliche Gesundheit seines Trainees – und darüber hinaus für die Gesellschaft. Denn der Coach will nicht nur das Unwohlsein oder Leiden des einen oder der einen Anvertrauten lindern; er weiß, dass gesunde, schmerzfreie und fitte Menschen auch viel besser dazu beitragen können, dass die Gesellschaft im Ganzen heiler wird – und dazu trägt er mit seinem Beruf bei. Dabei geht es nicht nur um bestimmte sportliche Bewegungen oder um eine Ernährungshilfe, nicht nur um die Stärkung der Muskeln als zum Beispiel darum, den Trainee von seiner körperlich und – oft damit verbundenen geistig „gebückten Haltung“ zu befreien. Der Klient oder die Klientin sollen wieder mit „aufrecht“ und mit „stolzer Brust“ ihren Beitrag zum Allgemeinwohl leisten können. Was den Trainer dabei geistig lenkt und wie er sich für seine Aufgabe aus christlicher Sicht ständig hinterfragen sollte, ist Thema dieses Beitrages.
Der Personal Trainer als „Erzieher“
Verschiedene Wege führen zum Beruf des Personal Trainers. Zunächst geht es um das Erlernen der technischen Praxis. Arbeitgeber setzen in der Regel staatlich anerkannte Lizenzen voraus, eine praktische Ausbildung in einem Studio mit Prüfung oder das erfolgreich abgeschlossene Studium an einer Hochschule. Im Zentrum der Formation zu diesem Beruf stehen zunächst objektive, sachlich zu fassende Lerninhalte: die Anatomie des Menschen, der Aufbau der Zelle und das Herz-Kreislauf-System. Angehende Trainer müssen also den menschlichen Bewegungsapparat begreifen und die Trainingslehre, um nur ein paar Punkte auf einer langen Lernliste zu nennen. Irgendwann steht dann die gerade ausgebildete Person das erste Mal in einem Studio und sieht sich – hoffentlich zunächst an der Seite eines erfahrenen Kollegen – vor dem ersten Trainee und soll ein Anamnesegespräch führen. Dieser Augenblick ist wie eine Taufe: Plötzlich gilt der Trainer, er oder sie – nur wegen eines erfolgreich abgeschlossenen Studiums oder staatlich anerkannter Zertifikate – als befähigt, einen Fremden zu trainieren.
Aber ist man in dem Moment tatsächlich gereift genug, um sich quasi als „Erzieher“ einer anvertrauten Person annehmen zu können? Die sachlich zu fassenden objektiven Lerninhalte mag der Trainer – oder eine Trainerin – verstanden und anwendbar zur Verfügung haben. Aber was geschieht in Kopf und Seele, wenn ein Mensch einem anderen gegenübertritt und ihn belehrt und schmerzfrei sowie fitter machen und damit erneuern möchte? Der Trainer gestaltet bisweilen das Leben seines Trainees in Bezug auf Bewegung, Ernährung und Sport vollends um. Er kann dabei zum Heiler werden. Dafür aber reicht das formale Wissen nicht, will er doch überzeugend und vorbildhaft und damit glaubwürdig auftreten. Tatsächlich ist der Lernstoff eines Studiums oder einer Lizenz wenig mehr als das Material, das der Trainer für seine Arbeit braucht. Mindestens genauso wichtig erscheint die Fähigkeit, eine belastbare Beziehung zwischen sich und dem Trainee aufzubauen; ein professionelles bis privates Band des Mitgefühls. Dieses Band ist „beweglich“; denn die Beziehung zwischen den beiden kann sich ständig verändern, weil sich der Trainer immer wieder neu an seine schutzbefohlene Person anpassen muss – und umgekehrt. Immer wieder dürfte sich dann im Berufsleben der Trainer die Frage stellen, was ihm eigentlich das Recht dazu gibt, einem anderen als Leitperson, als Heiler oder eben als „Erzieher“ gegenüberzutreten. Ist das nicht Anmaßung? Wie muss ein Trainer sein, damit er nicht arrogant und selbstbezogen daherkommt? Mit diesen Fragen befasste sich der Erzieher und Religionsphilosoph Romano Guardini. Der katholische Priester und Jesuit tat das als gläubiger Christ. Seine Antworten aber können für alle „Heiler“ gelten.
Das Vorbild: „Christus als rettender Therapeut“
Tatsächlich hilft der christliche Glaube, ohne Anmaßung gegenüber einem Fremden der Traineraufgabe gerecht zu werden; aber notwendig ist er nicht. Jesus Christus könnte das Vorbild eines Erziehers und Heilers sein. Eugen Biser – um für diese These nur einen Theologen zu nennen – hat die Rolle Jesu als Therapeut herausgearbeitet . Dieser römisch-katholische Ökumeniker schrieb, Christus habe sich weniger als Messias oder Weltenherrscher gesehen. Er habe vielmehr als Arzt und „rettender Therapeut auf die Menschen geblickt“. Biser entwickelte über diese Feststellung einen Entwurf zur „therapeutischen Theologie“. Dafür berief er sich auch auf das Evangelium des Markus (2,17). Dort sagt Jesus: „Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu berufen, sondern die Sünder“. Jesus erkenne letztlich alle Menschen als krank, weil fern zu Gott, bemerkte Biser . Jesus Christus unterscheide aber zwischen jenen „Gerechten“, die sich dieser Krankheit bewusst sind und denen, die nichts von ihrem Zustand ahnen und so besonders seiner Zuwendung bedürfen. Biser griff dann über die geistige Sünde und psychische Seelenpein der Gottesferne hinaus und bedauerte, dass das Christentum über seine 2000 Jahre alte Geschichte hinweg die umfassende Heilungskompetenz eines Priesters wie Jesus Christus „zur Gänze auf die wissenschaftliche Medizin“ übergehen ließ. Damit verband Biser das Plädoyer, mit dem Blick Christi seelische und körperliche Gesundheit wieder zusammen zu denken und so den Menschen ganzheitlich zu behandeln.
Mit dem Blick des Christus Medicus – Hospitalier und Trainer
Dieses Charisma leben bis heute die aus der Zeit des ersten Kreuzzuges im Mittelalter stammenden Hospitalier, die evangelischen Johanniter und katholischen Malteser. Dieser eine Orden mit seinen zwei Strängen gibt sich seit Anbeginn den Doppelauftrag, den Glauben an Jesus Christus zu verteidigen, indem er den „Herren Kranken“ jedweden Glaubens und Geschlechts zur Seite steht. Johanniter sehen Glauben und Medizin zusammen. Wohl genau deswegen sind sie auch nicht untergegangen, sondern bewahren bis heute ihre Strahlkraft. „Unsere Bruderschaft wird unvergänglich sein, weil der Boden, auf dem diese Pflanze wurzelt, das Elend der Welt ist, und weil, so Gott will, es immer Menschen geben wird, die daran arbeiten wollen, dieses Leid geringer, dieses Elend erträglicher zu machen,” konnte der (wohl) erste Vorsteher des Hospitals von Jerusalem, Propst Gerhard, um 1100 feststellen.
Dass Körper und Geist zusammengehören, wusste freilich immer auch die heidnische Welt; so im 1. Jahrhundert der Satiriker Juvenal in Rom mit seiner noch heute zitierten Aufforderung, der Mensch solle von den Göttern erbeten, „dass ein gesunder Geist in einem gesunden Körper sei. […] orandum est ut sit mens sana in corpore sano“. Tatsächlich ist es von jeher Erfahrung der Hospitalier, dass sie als Christen einst in die muslimische und jüdische sowie heute auch in die säkulare oder agnostische Welt hineinwirken können. Es geht mithin um Mission, wenn der Glaube mit seiner ganzheitlichen Seel- und Leibsorge alle erreichen soll, die sich beladen fühlen, krank sind und Schmerzen haben. In Jerusalems Hospiz der Johanniter nahmen so alle Schützlinge, egal welchen Glaubens, offenbar auch Muslime und Juden an der Liturgie teil. Mit diesem missionarischen Ansatz konnte Biser dazu aufrufen, seiner therapeutischen Theologie nicht einen irgendwie gearteten Sonderplatz im christlichen Denken einzuräumen. Biser forderte vielmehr, „die Theologie auf ihre angestammte – und wahrhaft angemessene – Grundgestalt zurückzuführen und sie, ihrer elementaren Aufgabe gemäß, in den Dienst des beschädigten, an sich und seinem Dasein leidenden Menschen zu stellen.“
Mit Jesu Blick auf das Ganze können – jenseits von Theologie und Kirche – Arzt, Therapeut oder Trainer sagen, sie vollzögen Jesu therapeutisches Anliegen und dienten damit dem „Christus Medicus“. Selbst wenn diese Ärzte und Trainer nicht religiös sind, wirken sie im Sinne des „rettenden Therapeuten“ Christus für des Menschen Gesundung. Auch wenn hier nicht näher auf eine Begriffsbestimmung für einen gesunden Menschen eingegangen werden soll, so bedeutet dieses Gesundsein allemal, nicht den Körper von der Seele zu trennen, sondern stets beides zusammen zu sehen. Die deutsche Sprache hat dafür einige Metaphern: Wer von jemandem sagt, er habe einen „geraden Rücken“, der meint nicht nur, dass diese Person aufrecht steht und darum eine gesunde Wirbelsäule hat; so eine Person zeichnet sich auch durch ihre festen Prinzipien und Werte aus. Der Begriff von der „stolzen Brust“ beschreibt nicht nur eine muskulöse Brust, er beschriebt Auch eine Person, die selbstbewusst bis eben stolz auftritt. „Mit beiden Beinen im Leben stehend“ meint, jemand ist geistig wie körperlich geerdet, nüchtern und „hält sich aufrecht“.
Sehnsucht nach paradiesischer Gesundheit
Gleichwohl bleibt es schwierig, „dieses Ganze“ – das Innere wie das Äußere – in Worte zu fassen. Es steckt darin eine überdisziplinäre oder gar kontemplative Erkenntnis, die nicht nur über einzelne Disziplinen wie Theologie oder Medizin, über Orthopädie oder Osteopathie hinausgreift. Zu diesem „Ganzen“ gehören Seele und Geist, Herz und Charisma. Auf dieses Ganze sieht der Blick Christi. Aber wie? Wie will uns Gott? Die Schöpfungsgeschichte gibt einen Hinweis. Da heißt es im ersten Buch der Bibel: „Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn; als Mann und Frau; männlich und weiblich schuf er sie“. Und was bedeutet diese Ebenbildlichkeit? Dazu steht in der Bibel: “Gott ist Geist”, laut Johannes 4:24. Gott soll also zunächst ohne Körper gesehen werden, weswegen sich das „Ebenbild Gottes“ vor allem auf den unkörperlichen Teil des Menschen bezieht. Der Mensch unterscheidet sich eben vom Tier; statt über einen Instinkt verfügt er über Willen und Freiheit, spricht von Moral und sozialer Ordnung. Gewiss ist auch der behinderte Mensch ein Ebenbild Gottes und in Gott geborgen. Andererseits sind wir von Anbeginn gewöhnt, die ersten Menschen Adam und Eva auch körperlich als Spiegelbilder Gottes zu begreifen; mit all ihren Nachkommen in perfekter Gesundheit, wären die Ureltern nicht aus dem Paradies vertrieben und mit der Pein von Schmerz, Krankheit und Tod beschwert worden.
So begreift sich die Sehnsucht nach einem gesunden Menschen als Wunsch, ihn wieder paradiesisch heil zu machen und ihm seine innere und äußere Harmonie der Schuldlosigkeit wiederzugeben. Auch in diesem Sehnen steckt das Wissen, dass Leib und Seele zusammengehören; dass ein Schmerz zum Beispiel nicht nur eine organische, sondern auch psychosoziale und seelische Ursachen haben kann. Bisweilen stecken viele Ursachen in nur einem Schmerzbefund und bilden ein schwer lösbares Beziehungsgeflecht.
Von der Diagnose über den Befund zu den Erkenntnissen eines Trainers
Aber nun zur Praxis: Für Trainer unabdingbar ist die Erkenntnis eines Arztes, meist aus dem orthopädischen Sektor, der seinem Patienten oder seiner Patientin nach seiner Anamnese und der Diagnose einen Befund mitgab. Der Orthopäde machte vielleicht Fehlstellungen in den Knien aus, die sich in der Hüfte auswirken, wodurch sie zu Schmerzen im unteren Rücken führen. Der Arzt kennt die Wirbelsäule, weiß von Knochen und Muskeln, hat vielleicht das Blut untersuchen lassen und weist an, die Schmerzen – nicht nur mit Medikamenten sondern eben auch mit gezieltem sportlichem Training – zu überwinden. Zu diesem Befund kommt in einem zweiten Schritt die praktische Erkenntnis des Trainers, der sich – bei seiner dann eigenen Anamnese – nochmals dem gesamten Körper-Seele-Mensch gegenübersieht. Er erkennt weitere Beschwernisse, die vielleicht noch nicht im ärztlichen Befund auftauchten: Der Mensch hat zwar (noch?) keine Schmerzen in den Füßen; aber er trägt viel zu enge Schuhe. Der Therapeut sieht, dass sein Gegenüber zwar (noch?) ohne Schmerzen in den Schultern ist, aber er geht leicht gebeugt. Sein Blick ist nicht geradeaus gerichtet, sondern wendet sich leicht zu Boden. Der Trainer hat sich den scheuen ersten Händedruck gemerkt, der wenig Selbstbewusstsein gespiegelt haben könnte. Auf diese Weise fügt sich zur theoretischen Erkenntnis des Arztes mit seinem Befund von Rückenschmerzen ein weiterer Eindruck des Trainers an: Dieser Mensch im Trainingsstudio steht wohl nicht mit beiden Beinen fest auf dem Boden, er hat keine „stolze Brust“.
Man kann sich dann den Trainer vorstellen, wie er den ärztlichen Befund mit seinem eigenen Eindruck vom gesamten Menschen abgleicht. In dieser Phase löst sich der Therapeut von klaren Befunden und beginnt sein Gegenüber als Schöpfung in seiner Umwelt zu begreifen. Haben seine Schmerzen wirklich nur organische Ursachen? Wie geht der Patient mit dem Schmerz um? Schmerzt ihn der Schmerz oder seine falsche Haltung? Will er sich für seine Gesundung auch aktiv einsetzen? Ist er bereit, für sein Heil zu kämpfen? Der Therapeut spricht mit seinem Gegenüber und begreift ihn in seiner Umwelt – mit seinen Beziehungen, nicht zuletzt auch mit der neuen Beziehung, die zwischen Trainee und Trainer entstehen wird. Kann der Therapeut wirklich helfen? Wird man gut miteinander auskommen?
Den Trainee zu seiner eigenen Harmonie führen
Über den ärztlichen Befund und dessen Rezept hinaus entwickelt sich auf dem Weg zum therapeutischen Training eine Beziehung zwischen Trainer und Patient, bei der das therapeutische Training – nach Biser – aus dem Blick des „Christus Medicus“ erfolgen kann. Der Trainer, der vielleicht keine oder weniger Schmerzen hat als sein Trainee, sieht sich seinem Patienten gegenüber, den er mithilfe seiner erlernten Kenntnisse in einen ähnlich guten Zustand versetzen möchte wie sich selbst. Er möchte ihn oder sie von den Schmerzen befreien und bestenfalls zu einem gesunderen Ebenbild Gottes machen. Das kann ein harter Prozess für den Schützling sein: Zunächst Herantasten an das Training: Das Stehen üben und dann erst ein leichtes, später vielleicht schweres Training mit Gewichten, Kniebeugen und Kreuzheben; Training der Schulter für die bessere Körperhaltung. Viel Schweiß und Muskelkater; Tipps für eine ausgewogener Ernährung und gesundere Lebensweise mit mehr Schlaf und weniger Stress. Dazu ein festes Trainings- und Ernährungsprogramm, dessen Einhaltung auch kontrolliert werden sollte. In jedem Fall mehr Bewegung als bisher und keine Scheu vor „guten Schmerzen“ wie dem Muskelkater. Im Kern geht es darum, die eigenen Grenzen spüren zu lernen und das mit dem Ziel, Körper und Seele in Harmonie zu bringen.
Der Trainer erklärt seinen langfristigen Plan, bei dem er Zwischenziele einbaut, um Erfolge sichtbar zu machen. Er muss auf Schwächen und Launen seines Gegenübers eingehen, womöglich motivieren oder aber – je nach Charakter – auch abbremsen, um genügend Ruhephasen zu ermöglichen. Bei diesem Prozess oszillieren die Beziehungen zwischen dem Blick Christi, zwischen Trainee und Trainer. Immer wieder wird die Vorstellung über das, was gesund und heilsam ist, so wie es der Schöpfungswille Gottes wünscht, an die Möglichkeiten des Trainees angepasst. Zwischen Trainer und Trainee kann auf dem Weg eine Art Freundschaft auf Zeit entstehen. Das Vertrauen wächst. Man hört aufeinander, und allmählich wird bei einem erfolgreichen Prozess der Trainee womöglich selber so gesund und kraftvoll, dass er sich am Ende der Trainingspläne für ähnlich stark und gesund empfindet wie den Trainer.
Dieser Heilungsprozess besteht nicht nur darin, dass Schmerzen verschwinden und der – vielleicht wegen seiner Knieprobleme belastete Mensch wieder geheilt zu laufen versteht. Tatsächlich kann unter diesem Blick Christi mehr geschehen, wenn durch das Charisma und die Zuneigung des Trainers auch innere, seelische Belastungen des Patienten wegschmelzen. Immer wieder Bestärkung und neue Erfolgserlebnisse erleichtern es dem Patienten, sich in seinem Selbstwertgefühl gesunder und stärker zu fühlen. Und in dem Maße, wie seine Knie schmerzfrei und seine Hüften wieder mobilisiert sind, fällt es dem Patienten leichter, sein Haupt zu erheben und den Blick geradeaus zu richten. Am Anfang der Therapie sah sich der Trainer selbst noch dem Ebenbild Gottes näher. Zu ihrem Ende könnte es sein, dass der Trainierte quasi aufgeschlossen hat. Der Gesundete ohne Schmerzen und mit „stolzer Brust“ ist dann aus der Bindung des Trainers heraus in eine neue Freiheit unter dem Blick Gottes hineingewachsen. In der Regel löst sich darüber die Beziehung auf und der Ex-Trainee geht seiner Wege. Ein gutes Ende.
Die Glaubwürdigkeit des Trainers
Aber solche Erfolge sind nicht selbstverständlich. Vielleicht schmelzen bei dem Schutzbefohlenen die Schmerzen trotz allen Bemühens nicht davon; vielleicht ist der Trainee nicht bereit, für seine Gesundung auch zu schwitzen und gibt auf! Darüber dürfte der Trainer in Selbstkritik verfallen, weil er sich seiner Aufgabe nicht gewachsen sieht, sondern versagt zu haben glaubt. Hat er sich überschätzt? Romano Guardini stellte bei einer pädagogischen Tagung die dazu passende, allgemeine Frage an einen jeden Erzieher: „Wie kommst Du eigentlich dazu, einen anderen erziehen zu wollen? Woher nimmst Du das Recht zu durchblicken, zu beurteilen, zu fordern? Wenn doch der andere Mensch eine Person ist mit Freiheit und Würde – wie kommst Du dazu, diesem Menschen sagen zu wollen, wie er werden soll?“
Guardini beschreibt diese Selbstzweifel als wichtige Hilfe, als geradezu „heilige Unzufriedenheit“. Ein Erzieher müsse begreifen, dass er nie „fertig“ ist, „sondern beständig wachsen und werden“ muss. Seine Glaubwürdigkeit ergebe sich geradezu dadurch, dass er auch um seine eigene Entwicklung kämpfen müsse. Erst dieser Kampf gebe „erzieherische Glaubwürdigkeit“. Bei dem Erziehen gehe es darum, diese eigene Bewegung auch im Gegenüber zu wecken. Erziehen bedeutet, „dass ich diesen Menschen Mut zu sich selber gebe. Seine Aufgabe zeige, seinen Weg deute…. dass ich ihm helfe zu seiner eigenen Freiheit. Ich habe also ein lebendiges Geschehen in Gang zu bringen,“ sagt Guardini, indem er von sich als dem Erzieher spricht . „Leben wird nur durch Leben entzündet.“ Es geht also um eine Wechselbeziehung: „Nur weil ich um mein eigenes Besserwerden ringe macht meine pädagogische Bemühung um den anderen glaubwürdig.“ Für den Theologen Guardini heißt das: „Der Mensch ist dem Menschen Weg zu Gott.“
Guardini beschreibt diesen Prozess von Scheitern und Erfolg als „Übung“. Es ist „das Wesen der Übung, dass sie aus der Klarheit der Erkenntnis hervorgeht, und sich langsam ins Sein senkt. Das Erkannte und Gewollte „vitalisiert“ sich. Es wird zum Bestandteil unserer lebendigen Faser. Und allmählich ist das Gesollte nicht mehr Gegenstand, Objekt, sondern Subjekt; es gehört zu unserem Sein. Es spricht aus uns selbst her.“ Nur über diese „heilige Unzufriedenheit“ und das immer wieder neue Ringen um ein „eigenes Besserwerden“ kann der Mensch zu einem guten Erzieher, oder eben Trainer werden – wobei ihn das Ringen stets begleiten wird.
Zusammenfassung
Die meisten Therapeuten dürften Agnostiker sein, und kaum jemand von ihnen dürfte je etwas von Romano Guardini gehört haben. Doch auch der ungläubige Trainer verrichtet das Werk Gottes. Bei seiner Ausbildung lernt jeder Trainer den Knochenbau des Menschen und seine Muskeln, erfährt vom Atmen und dem Blutkreislauf, muss die verschiedenen Formen von Kraft und Bewegung studieren und lernt die zahlreichen Trainingsmethoden kennen. Vom „rettenden Therapeuten“ Christus Medicus ist dabei nicht die Rede. Dabei wissen wohl alle Trainer, in welche Richtung sie ihre Kraft und ihr Charisma einsetzen. Sie haben nach ihren Erfahrungen – ohne es zu wissen oder auszusprechen – eine ziemlich genaue Vorstellung von diesem paradiesischen Ebenbild Gottes, das gesund, ohne Schmerzen auf beiden Beinen selbstbewusst im Leben steht. Ein guter Trainer ist beseelt davon, seinem Gegenüber ein gutes Vorbild, eine gute Hilfe und eine stärkende Hand zu sein. Aber der gute Trainer, die gute Trainerin ist nie fertig, er oder sie verändert sich in Selbstzweifeln immer weiter und schafft sich ständig neu. Der Trainer wandelt sich mithin genauso, wie sich auch der Schützling ändert und stets neu erschafft. Beide legen wohlmöglich eine ähnliche Strecke der Zweifel und Schmerzen, der Heilung und Stärkung zurück. Trainer und Schützling gehen dabei auf eine emotionale Reise – wie sie bei jeder Beziehung auf ihre eigene Art und ständig in Bewegung vollzogen wird, zwischen Frau und Mann, zwischen Kind und Eltern.
Ein Trainer kann wohl gewisse Techniken von Mitgefühl lernen; letztlich aber ist sie eine Gabe und wird verstärkt durch den Wunsch, sich für etwas Ganzes im Gegenüber zu öffnen und ihm ein Wandergefährte, Anleiter, Heiler und Vorbild zu sein. Wenn Trainer auch in den Augen vieler und nach ihrer eigenen Anschauung nicht Gottes Auftrag verrichten oder mit dem Blick Christi sehen, so leisten sie doch gerade in unseren gehetzten und (vor dem PC) „sitzenden“ Zeiten einen unermesslich wichtigen Beitrag für die umfassende Gesundheit und Heilung unserer Gesellschaft. Sie dienen der Gesundung des Trainees und damit der Gesellschaft. und so dienen sie Gott. (jöb.)
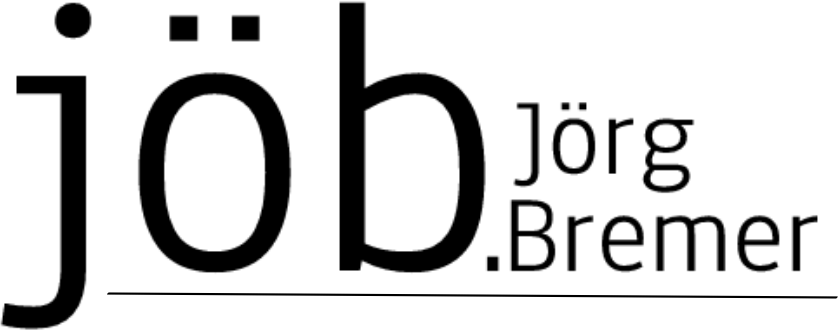
15 thoughts on “Personal Training als gesellschaftlicher Auftrag –”
Artificial intelligence creates content for the site, no worse than a copywriter, you can also use it to write articles. 100% uniqueness :). Click Here:👉 https://stanford.io/3XYPFqb
Waiting patiently for you to come home and fuck me! https://bit.ly/3UKFVxa
Waiting patiently for you to come home and fuck me! https://bit.ly/3UKFVxa
Waiting patiently for you to come home and fuck me! https://bit.ly/3UKFVxa
промокод мелбет. Click Here:👉 http://lynks.ru/geshi/php/?melbet_promokod_pri_registracii_2020.html
промокод melbet. Click Here:👉 http://lynks.ru/geshi/php/?melbet_promokod_pri_registracii_2020.html
промокод мелбет на сегодня. Click Here:👉 http://lynks.ru/geshi/php/?melbet_promokod_pri_registracii_2020.html
Waiting patiently for you to come home and fuck me! https://bit.ly/3UKFVxa
Waiting patiently for you to come home and fuck me! https://bit.ly/3UKFVxa
Waiting patiently for you to come home and fuck me! https://bit.ly/3UKFVxa
Waiting patiently for you to come home and fuck me! https://bit.ly/3UKFVxa
Waiting patiently for you to come home and fuck me! https://bit.ly/3UKFVxa
Waiting patiently for you to come home and fuck me! https://bit.ly/3UKFVxa
Waiting patiently for you to come home and fuck me! https://bit.ly/3UKFVxa
Waiting patiently for you to come home and fuck me! https://bit.ly/3UKFVxa
Comments are closed.