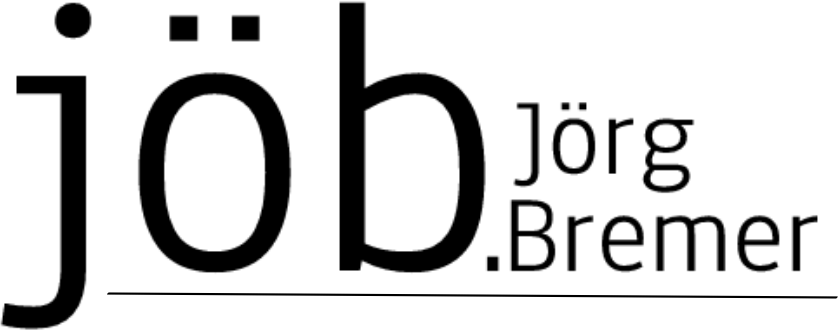(Lesezeit 4 Minuten)
Berlin, den 16. Juni, 2020
Lieber Philipp,
Heute möchte ich einmal einmal wieder über Europa schreiben. Aber ich will das nicht auf die EU und damit auf das Geld einschränken, geht es derzeit in Brüssel doch offensichtlich nur um diese 750 Milliarden, die erst Frau Merkel und Macron angeboten haben und die nun Frau v der Leyen beraten lässt. Der italienische Ministerpräsident Conte hat dieser Tage – nach diesem Gelde hechelnd – bei einer „Dringlichkeitskonferenz“ mit der EU-Spitze beteuert, dass es nach dem „beispiellosen Schock“ durch Covid In Italien nicht einfach so weitergehen dürfe. Italien habe durch die Pandemie «sehr hohe menschliche, soziale und wirtschaftliche Kosten» erlitten. Es brauche darum ein «mutiges Projekt», um aus der Krise herauszukommen. Er teile die Auffassung der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, dass sich Europa eine «Rückkehr zum Status Quo» wie vor der Krise nicht leisten könne, sagte Conte.
Italien, das wohl der größte Nutznießer des Geldregens sein dürfte, räumt sogar eine Bringschuld seines Landes ein. Es müsse die Chance genutzt werden, in der Krise alle Hindernisse zu beseitigen, die Italien in den vergangenen 20 Jahren gebremst hätten. Konkret nannte der Regierungschef eine effizientere öffentliche Verwaltung, mehr Digitalisierung, Umweltschutz und einen stärkeren Kampf gegen Ungleichheit und Armut. Conte ging damit auf Frau von der Leyen ein, die Rom ins Gewissen geredet hatte: Wenn Italien bald große Summen aus einem überwiegend schuldenfinanzierten EU-Corona-„Wiederaufbaufonds“ erhalte, dann müsse es die überfälligen Reformen anpacken: „Wir, die EU, verleihen zum ersten Mal Geld von unseren Kindern. Also müssen unsere heutigen Investitionen Früchte für unsere Kinder tragen.“ Sie fügte hinzu: „Wir werden nicht, wie es manchmal unsere Mitgliedstaaten taten, Geld von unseren Kindern leihen, nur um heute mehr auszugeben.“
Tatsächlich wissen wir von der Berichterstattung meines Kollegen Pillers, dass die italienischen Regierungsparteien „Fünf Sterne“, PD und der kleine Renzi-Club über die also anstehenden Reformen heftig zerstritten sind; weswegen sie das Thema auch unverzüglich in ein größeres Format – gli stati generali dell`Economia – verlagerten, wo zum Beispiel die Gewerkschaften traditionell als Oberbremser unterwegs sind. So schob Conte auch gleich nach, es gehe nicht nur um das Schicksal Italiens, sondern um „gemeinsame Interessen“. Für mich klang das nach Ablenkung, obwohl ich genau solchen „Interessen“ in den nächsten Zeilen nachgehen möchte. Welche europäischen Gemeinsamkeiten mögen das sein?
Heute noch kann ich mich gut an den Januar-Tag 2015 erinnern, als der damalige Ministerpräsident Renzi die Bundeskanzlerin Merkel nach Florenz eingeladen hatte. Der um „europäische Bilder“ nicht verlegene Renzi beendete seine Stadtführung vor dem riesigen David des Michelangelo, vor der die beiden Politiker klein und mickrig wirkten. Der große David sei ein unsterbliches „Symbol“ für Europa und seine Ästhetik. Man dürfe mit solchen Symbolen im Rücken nicht nur über Wirtschaft und Geld reden: „Wir müssen Europa neu erzählen.“ Ohne Zweifel trug die Renaissance Michelangelos oder Leonardo da Vincis zur Wiederentdeckung einer geographischen europäischen Einheit bei; nicht zuletzt, weil sie die im grenzenlosen „Imperium Romanum“ lebendige römische Klassik – in Philosophie und Kunst – wiederaufleben ließ. Tatsächlich begann im gleichen Atemzug allerdings mit der Reformation die Bildung der Nationalstaaten, die das visa-lose Reich der römischen Kaiser, Karolinger und Ottonen gleich wieder und bis heute politisch zerstörte.
Ich freute mich damals in Florenz, dass Renzi die kühle aber neugierige Merkel auf die Kultur Europas hinwies und ärgerte mich nur wenige Minuten später, als meine FAZ-Redaktion in Frankfurt mir klar machte, dass es ja wohl nicht wahr sein könne, dass bei einem solch politischen Treffen die EU-Kultur ins Zentrum gerückt worden sei. Das sei doch nur Kulisse. Tatsächlich sind die um – vermeintlich harte – Fakten bemühten Redaktionen genauso schuld an dem Verfall Europa, wie jene Politiker, die stets nur über das Geld reden. Um Geld streiten wir, um Grenzen und Flüchtlinge. Wir aber müssen Europa anders erzählen, um einander wieder näher zu kommen.
Das jüngste Buch von dem in Italien sehr bekannten Schriftsteller Paolo Rumiz, „Der unendliche Faden“ ( https://amzn.to/2Y2eBA8) macht deutlich, auf was Europa tatsächlich gründet und was auch zusammenhält. Rumiz reiste dafür „zu den Benediktinern, den Erbauern Europas“. So wie es vor politischen Redakteuren leider schwierig ist, über Kultur zu reden; so ist es fast unmöglich, heute noch über Religion und Kirche zu sprechen und zu schreiben. Also bitte Geduld! Tatsächlich nämlich trugen das Christentum und so auch Mönche Unerschöpfliches zur Schaffung Europas bei. Die Ordensregel des Benedikt von Nursia, (dessen uraltes Kloster wir vielleicht mit Dir besucht haben, auch wenn das Gründungskloster Benedikts 529 Montecassino gewesen ist) ist heute 1500 Jahre alt. Aber mit ihr kamen heute weiterhin gültigen demokratischen Regeln in das damals verfallende spätrömische Reich. Mit Erstaunen sahen die von Häuptlingen und Grafen beherrschten Menschen, dass Herrschaft nicht nur durch Waffengewalt oder vom Vater ererbt werden kann. Im Kloster wählten die Mönche gleichberechtigt ihren Abt. In der Ordensregel wird festgelegt, wie unabhängig das zu geschehen habe. Über ganz Europa legten die Benediktiner ihre Klöster und schufen damit ein Netz der neuen Ordnung.
„Ora und Labora“ ist bekanntlich ihre Grundregel. Die Handwerke, die man in Rom beherrschte, wurden von den Benediktinern über die Alpen getragen. Der Bau einer Kathedrale oder der Klöster geschah von Bauleuten aus allen europäischen Ecken. Das Wanderwesen der Handwerker begann damals. Mutmaßlich wäre niemand auf den Gedanken gekommen, einen ungarischen Klempner, den ein ungarischer Benediktiner-Abt nach Sankt Ottilien empfahl, als Ausländer zu schmähen. Denn nur sein Handwerk zählte. O. k., es war nicht so leicht mit der Sprache. Aber die Benediktiner konnten mit dem verbindenden Latein aushelfen. In allen Klöstern von Italien bis zur Bretagne wurde zur selben Zeit und pünktlich mehrfach am Tag gebetet. Die Einteilung des Tages nach Uhrzeit in Verbindung mit der Sonne prägte sich so bei den Menschen ein. Pünktlichkeit ist keine preußische Tugend; sie ist weit älter.
Als die Benediktiner vollgefressen waren, spalteten sich von ihnen die wieder strengen Zisterzienser – benannt nach ihrem Gründungskloster Cîteaux (1098) ab. Diese legten ein zweites, größeres Netz von Klöstern über Europa von Frankreich bis zu den livländischen Pruzzen. Das benediktinische Reformkloster Cluny, von dem die Bewegung ausging, und Bernhard von Clairvaux prägten den neuen Orden. Gegen Schluss der Reise heißt es bei Rumiz: „Ich habe das Gefühl, ich bin nicht so sehr von Abtei zu Abtei, sondern inmitten der Werte gereist, auf denen Europa beruht. Arbeitseifer, Schweigen, Erfindungsgeist, Gastfreundschaft, Gesang und – warum nicht – Demokratie.“ Zugleich spürt Rumiz, der ein Plädoyer für die Aufnahme von Fremden ablegt, „die Weiblichkeit die Zerbrechlichkeit dieser Welt. Ich mache mir Sorgen um das Schicksal Europas; vielleicht wird es von der Globalisierung hinweggefegt, deren Komplizen Profis der Angst sind.“
Es käme darauf an, die Politiker von der Linken über SPD und CDU bis zu den AfDlern daran zu erinnern, dass ihr europäisches Erbe weit älter ist und tiefer in das tägliche Leben eingreift, als die erst vor 500 Jahren aufgekommene Nationalstaatlichkeit. Deutschland ist viel jünger als Europa. Jenes alte Europa war dabei offener für das Fremde; denn natürlich waren die Mönche in Livland anders als in Frankreich. In der Lombardei mögen sie mehr Wein getrunken haben als Bier wie die in Deutschland, obwohl gerade das Bier – aus dem alten Ägypten stammend – über die Mönche der Ostkirche und die Benediktiner unter anderem auch in Bayerns Alt Ötting kam. Aber diese Mönche lebten überall nach denselben Regeln, die sie zum Beispiel an die freien Städte abgaben.
Mithin ist es tragisch, dass es unter Frau von der Leyen weiterhin nur um das Geld geht. Die von Conte beschworenen „gemeinsamen Interessen“ kreisen mutmaßlich auch nicht jenes gemeinsame europäische Erbe, das Renzi noch beschwor und dass wir heben müssen, damit vor aller Welt klar wird, dass Europa in sich eine Identität zu verteidigen hat. Dabei kommt mir ein Zitat aus dem Rumiz-Buch in den Sinn. „Auf meinen Reisen habe ich verstanden: kein westlicher Politiker hat den Namen Europas jemals so leidenschaftlich ausgesprochen wie eine alte, arme ukrainischer Hirtin namens Ljuba, die ich am Ufer des Dnister kennen lernte.“ Rumiz erinnert sich auch an einen Abend in Tiflis in Georgien, wo die Neunte von Beethoven ausgeführt wurde. Als die Ode an die Freude erklang, sei das Publikum aufgesprungen und habe den Chor enthusiastisch begleitet. „In Rom, Berlin, Brüssel wäre das unmöglich. Als ob das Herz des Kontinents nicht in, sondern außerhalb der EU schlüge.“ Mithin stimme ich Rumiz zu: „Wir müssen Europa neu erzählen.“ Und damit auch, was all jenen fehlt erwähnen, die gerne EU wären.
Sei doll umarmt
Der Aba