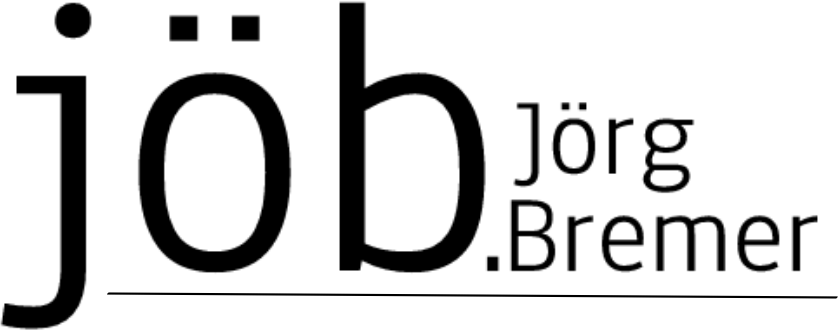( 7 min Lesezeit) Ich habe nur in Rom meine Heimat-Bar – Sie ist nah, aber es ist nicht die nächste zu meiner Wohnung in der Via Santa Chiara. Die Wahl war nicht einfach. Drum muss der Auswahlprozess erzählt werden. Aber zunächst kommen Sie einfach mit zur Piazza Fontana di S. Andrea della Valle (beim Corso Vittorio Emanuele II) und dort ins Eck-Café beim Largo del Teatro Valle. Dort ist Sylvia die Frau an der „Valle-Bar“ und Chefin der Kaffeemaschine. Ihr „guter Bekannter“, der Professor P. sitzt in der Regel schon gegen acht Uhr vor seinem Computer und arbeitet ein Stündchen oder mehr, in jedem Falle lange über die Zeit seines einen Morgencappuccinos hinaus. Er gehört zu den Chefs einer irischen Uni, die Fernstudien organisiert, aber arbeitet als Römer von Rom aus: „Der Computer verbindet uns. Für die Studenten in Fernost oder Schwarzafrika ist Rom genauso weit weg wie Dublin.“ Das sagt der Politologe so gegen neun Uhr.
( 7 min Lesezeit) Ich habe nur in Rom meine Heimat-Bar – Sie ist nah, aber es ist nicht die nächste zu meiner Wohnung in der Via Santa Chiara. Die Wahl war nicht einfach. Drum muss der Auswahlprozess erzählt werden. Aber zunächst kommen Sie einfach mit zur Piazza Fontana di S. Andrea della Valle (beim Corso Vittorio Emanuele II) und dort ins Eck-Café beim Largo del Teatro Valle. Dort ist Sylvia die Frau an der „Valle-Bar“ und Chefin der Kaffeemaschine. Ihr „guter Bekannter“, der Professor P. sitzt in der Regel schon gegen acht Uhr vor seinem Computer und arbeitet ein Stündchen oder mehr, in jedem Falle lange über die Zeit seines einen Morgencappuccinos hinaus. Er gehört zu den Chefs einer irischen Uni, die Fernstudien organisiert, aber arbeitet als Römer von Rom aus: „Der Computer verbindet uns. Für die Studenten in Fernost oder Schwarzafrika ist Rom genauso weit weg wie Dublin.“ Das sagt der Politologe so gegen neun Uhr.
Zu dieser Zeit kommt meist im abgetragenen Jackett und altem Loden Fürst M, der in der Nachbarschaft in seinem herrschaftlichen Palais residiert, aber auf Äußerlichkeiten keinen Wert legt. Als wir ihn vor Jahren das erste Mal bei einer Abendeinladung trafen, hatte der Grande darauf hingewiesen, dass seine Familie einen 2000 Jahre alten Stammbaum habe und damit die älteste in Rom sei. Das stimmt wohl nicht, sagen Historiker. Aber was tut das zur Sache? Ich sehe il Principe M. mittlerweile immer wieder beim Kaffee. Dabei geht über Floskeln das Gespräch nicht hinaus: „Wie geht es denn Ihrer Frau?“ fragt der Morgenmuffel und schluckt seinen „Cappuccio“. Dann geht er rasch wieder. Besonders rasch, wenn sein „roter Nachbar“ kommt, der Ex-Chef der sozialdemokratischen Partei (PD) Pier Luigi Bersani, um hier auch seinen Morgencafé zunehmen, mit einem Packen Zeitungen unter dem Arm.
Der Cappuccino morgens in der Bar ist für den Italiener fast so etwas wie die Messe am Sonntag. Es ist immer dieselbe Bar – so wie es stets dieselbe Gemeindekirche und dieselbe Uhrzeit. In der Regel sind es auch dieselben Leute, die sich zu ähnlichen Gesprächen treffen, eine morgendliche Gemeinde, die mit dem Cappuccino ihren Alltag beginnt. Im Zentrum dieses Treffens ist natürlich die Person an der Kaffeemaschine. Das ist meistens ein Mann in weißen oder schwarzen Hemd, also in einem würdigen Habit wie der Priester bei der Messe. Aber anders als in der katholischen Kirche gibt es im Café auch Frauen, die diesen Ritus vollziehen und ihren Kunden bei einem vertrauten Gespräch den Eintritt in den Alltag erleichtern. In der Valle-Bar ist Sylvia die Kaffee-Priesterin. Ihr hilft neben der polnischen Frau, die herrliche Salate zum Lunch zaubert, eine Freundin als „Arbeitskollegin“. Sie „hilft“ freilich nur augenscheinlich. Denn ihren gräflichen Eltern gehört der gesamte barocke Palazzo über dem Café. Sie muss nicht arbeiten, „aber man muss ja etwas tun!“, sagt sie mal. Zwei Angestellte von einem Sicherheitsdienst mit dunklen Anzügen und weißem Hemd mit Krawatte machen der Gräfin den Hof.
Pünktlich um neun legt ein Team von der Müllabfuhr in der Bar eine Pause ein. Da wird gelacht, und die Kaffeemaschine läuft auf Hochtouren. Wenn kurz darauf der Milchmann kommt, sind die Leute von der Müllabfuhr schon wieder weg. Worüber man redet? Wie der Principe möchte sich nach ihm im Café auch Bersani zu dieser frühen Stunde nicht in schwierige Gespräche verwickeln lassen. Aber immerhin macht er immer mal wieder mit knappen Floskeln deutlich, dass er alles besser weiß. Ihn treibt wohl immer noch sein linkes Herz der sozialistischen Bewegung um, auch wenn die Italiener längst nichts mehr von Ideologien wissen wollen. Lieber links als in der Mehrheit, scheint auch ein Motto von Bersani zu sein, der die Sozialdemokraten in die Spaltung führte. Bersani lebt, anders als der Fürst, in einem der Häuser nebenan zur Miete. Meist wird er im Café von einem Mitarbeiter abgeholt. Derweilen erscheint in unregelmäßigen Abstand ein würdig gekleideter Herr, in der Regel in dunklem Anzug, der von einem livrierten Diener begleitet wird. Der Chef bespricht dann mit seinem Angestellten bei einem Kaffee die Aufgaben des Tages. Man grüßt sich höflich. Aber kein Gespräch. Sylvia sagt, dem Herrn gehöre der Palazzo in der Nebenstraße. Er sei „Unternehmensberater oder so etwas“. Sylvia weiß vieles, aber Diskretion muss auch sein.
Bei der Auswahl seines Cafés für den Morgencappuccino darf man nicht fahrlässig verfahren. Schließlich geht es nicht nur um den besten Morgentrunk in der Nachbarschaft. Es geht auch um die Gesellschaft, auf die man im Café stößt und natürlich um den Preis. Gerade im Zentrum der Stadt, wo Touristen das Leben bestimmen, kostet der Kaffee deutlich mehr als an Roms Peripherie. Und auch wenn man mit dem „Barista“, also dem Kaffeebrauer, übereinkam, dass man als Nachbar weniger zahlen dürfe denn der Tourist, bleiben doch erhebliche Preisunterschiede. Auch muss man übereinkommen, dass stets der niedrigere „Preis an der Bar-Theke“ zu bezahlen sei, selbst wenn man sich draußen auf die Piazza setzen will.
Den besten Kaffee in der Nachbarschaft mag es wohl gegenüber der Kirche von Sant´Eustachio im „Il Caffé“ geben. Aber diese Einrichtung ist vor allem Touristen vorbehalten: mithin zu voll, zu viele Fremde und eben auch teuer. Wohlmöglich lässt sogar unter dem Ansturm der Besucher die Kaffee-Qualität nach. Das kleine Café neben der Kirche stand einmal in Ruf, von der Mafia gelenkt zu werden. Mittlerweile sind dort aber junge Leute aktiv, denen man diesen Vorwurf nicht machen kann. Die Bedienung ist höflich, schnell und freundschaftlich. Aber auch dort herrscht viel Betrieb. Nicht nur die Senatoren und ihre Mitarbeiter, die im nahen Palazzo Madama arbeiten, trinken hier ihren Morgenkaffee. Während der Schulzeit treffen sich auch die Mütter dort, nachdem sie ihre Kinder in die nahe Grundschule brachten, – und bei dem Geschnatter kann man keinen Cappuccino genießen.
So riet der Freund, der sich in dieser Nachbarschaft bestens auskennt, weil seine fürstliche Familie ihren angestammten Palast in einer Nebenstraße hat, man solle doch das etwas abgelegene Café am Largo del Teatro Valle gleichen Namens wählen. Das tat ich. Die Frau in der Bar, jene Sylvia, war zuerst ein wenig reserviert. Man muss sich ja auch erst einmal kennenlernen. Mittlerweile beglückwünscht sie den deutschen Besucher, wenn dessen Zeitungsbeiträge im Rundfunk zitiert wurden, und die Valle-Bar ist der morgendliche Treffpunkt mit Freund F., einem deutschen Filmproduzenten, der mit seiner Familie auf der anderen Seite des Corso lebt: „Treffen wir uns zum Frühstück?“ hieß es anfangs per SMS. Jetzt reicht „K?“ für Kaffee. Und zur Antwort „J“ wie ja. Und Sylvia fragt, wenn zunächst nur einer von uns erscheint: „Wir warten noch?“ F bekommt seinen Cappuccino mit einem Hauch von Schokolade. Ich ziehe ihn ganz heiß im Glas vor. Aber das muss man nicht jedes Mal wiederholen. Sylvia weiß Bescheid. Sie kennt uns nun.
Bei ihrem Frühstück italienischer Art – nur Cappuccino und Cornetto – nehmen es die beiden Deutschen in Kauf, dass zu ihrer Zeit oft jene Frau mit im Café ist, deren Hund bisweilen unleidlich bellt. Geradezu lästig war einige Wochen lag der Bettler, der das WC in der Bar benutzen durfte und sich daran gewöhnte, von uns einen Kaffee spendiert zu bekommen – freilich draußen, wo Sylvia zwei Metalltische aufgestellt hat. Spätestens wenn der philippinische Blumenhändler für seinen „Cappuccio“ kommt, um daraufhin sein Geschäft zu eröffnen, ist Schluss mit der Morgenrunde, und der Arbeitstag muss beginnen. jöb.