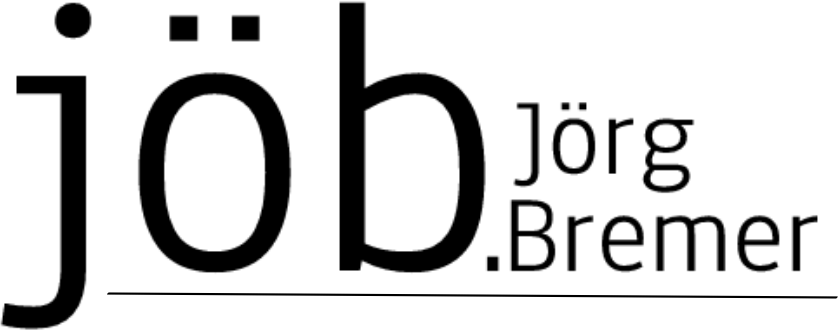Vortrag vor einem christlich-konservativen Freundeskreis – dem “Gelben Kreis”
(Lesezeit 10 Minuten) Um es gleich vorweg zu sagen: Es steht nicht gut um die Ökumene in Deutschland. Zumindest wenn man nicht nur das praktische Miteinander meint, sondern eine theologisch gut begründete Gemeinsamkeit über jene sonderbare Formulierung einer „Versöhnten Verschiedenheit“ der Konfessionen hinaus. Mithin steht es auch nicht gut um die Hoffnung, dass Evangelische, zumindest Lutheraner, und Katholische demnächst gemeinsam aus dem einen Kelch des Herrn trinken, wie ich es mir schon so lange nach meinen Erfahrungen in Jerusalem und Rom sowie theologisch gut begründet erhoffe. (Ja, dazu gibt es eine Aufsatzsammlung in dem Buch von mir mit dem fordernden Titel „ein Kelch für zwei“.)
Aber es gibt eben auch nicht nur eine Kirchen- und Glaubenskrise, wie unser Titel zum Vortrag vermerkt. Wir könnten als ihre tiefere Ursache von einer Identitäts- und Bekenntniskrise sprechen und nicht nur von einer der Kirchen. Es geht vielmehr um eine Bekenntniskrise vieler, wenn man ihm oder ihr die Frage stellte, wie sie sich als Persönlichkeit selber sähe, was ihre Identität ausmache und wie sie sich mit ihren Eigenschaften und ihrem Selbstverständnis in die Gesellschaft einbringen soll.
Deswegen will ich meinen Vortrag in einen größeren Zusammenhang stellen: Es soll nicht um Ökumene im engeren Sinne gehen, sondern um uns als Gesellschaft und im Besonderen als Mitglieder in diesem christlich-konservativen Freundeskreis der Gelben. Dafür nehme ich mir einen oft zitierten, weil lesenswerten Brief des Propheten Jeremias zur Hilfe. Jeremias schrieb aus Jerusalem an seine verunsicherte Gemeinde, die gerade ins babylonische Exil geführt worden war und nicht wusste, ob sie in der Fremde überhaupt ankommen und ihre Koffer mit den Eigenschaften, Identitäten und Bekenntnissen auspacken sollte.
Der babylonische König Nebukadnezar hatte 587 v. Chr. Jerusalem erobert und die Eliten der Stadt mit sich in seine Heimat zurückgenommen und so an Euphrat und Tigris in die Fremde verbannt. Dort mischten sich offenbar bald Populisten unter die Heimatlosen und gaben billigen Rat. Man solle sich von so erlesener Herkunft und Gottesnähe geprägt gar nicht erst in dieser Fremde einrichten, sondern besser im Protest gegen die Verbannung und Obrigkeit verharren. Morgen oder übermorgen gehe es gewiss wieder in die Heimat zurück. Also totstellen – gar nicht erst die Koffer auspacken.
Jeremias sieht das völlig anders und lässt, wie es gute Propheten tun, den Herrn Zebaoth, den Gott Israels sprechen und schreibt seine Weisung an die Entwurzelten quasi in dessen Namen: „baut Häuser und wohnt darin“, fordert Jeremias sie auf, „pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, nehmt Euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter…. damit ihr nicht weniger werdet. Sucht der Stadt Bestes, dahin ich Euch habe wegführen lassen. Betet für sie zum Herrn; denn wenn‘s der Stadt wohl geht, dann geht es auch Euch gut“.
Das trägt Jeremias den Entführten und Heimatlosen auf: Koffer auspacken und den Neustart versuchen. Diese Anweisung richtet sich nicht nur an die Anführer, sondern an jeden einzelnen der Exilierten, denn der Prophet bittet alle, die jeweils eigenen Fähigkeiten dazu zu nutzen in dieser fremden Stadt der Sieger, in diesem Babylon zum Wohl der gesamten Gesellschaft beizutragen. Das sollen sie freilich nicht irgendwie, sondern mit ihrem Bekenntnis als Anhänger des Gottes Israels tun; sie sollen sich nicht verstecken, sondern selbstbewusst das Ihre zum Wohl des Ganzen beitragen. Die Leute aus Jerusalem sollen mithin in Babylon – oder sonst wo im Zweistromland – Wurzeln schlagen und in aller Gelassenheit auf Gott vertrauen, denn der habe sie schließlich doch auch in diese Verbannung geführt, schreibt Jeremias. Ein jeder solle sich also als bekennender Israelit um das gemeinschaftliche Leben, um die Ökumene in der fremden Umgebung kümmern – nicht anders als der Einheimische auch.
Sie können sich vorstellen, dass sich so einen Aufruf natürlich auch an die Einheimischen richten muss, die womöglich nur an sich selbst und ihr eigenes Fortkommen denken, die sich wohlmöglich unpolitisch bis unsozial verhalten. Jeremias hebt geradezu die Unterscheidung zwischen fremd und zuhause auf, spricht von der einen Stadt aller und wendet sich mit seiner Anweisung aus der Feder Gottes an jeden einzelnen – ja auch an uns. Jeder von uns solle sich – wo auch immer – mit seinem Sein und Können einbringen.
Verdammt, dachte ich mir, als ich soweit war! Ich auch? Was könnte ich zum Beispiel einbringen, in welcher Identität stehe ich vor Ihnen, vor euch – um mal bei mir anzufangen. Habe ich überhaupt ein Bekenntnis, das ich leben und zeigen könnte, so wie es Jeremias von seinen Israeliten in Babylon verlangt? – Diese Frage brachte neulich ein sehr guter Freund in Rom vor, als ich ihm von diesem Vortrag berichtete. Er frug: Was kannst Du einbringen, was nicht jeder andere auch einbringen kann? Wenn Du schon von anderen den Bekennermut verlangst; was ist denn eigentlich Dein Bekenntnis?
Ziemlich kniffelig, dachte ich zunächst. Bin ja ziemlich viel in Europa zwischen Polen, Deutschland, Israel und Italien rumgekommen; und habe mir dabei doch bestimmt jegliche Identität abgewöhnt?! Freund Ferdinand schüttelte den Kopf; lass uns nur von Deinem Glauben und der Religion reden, fügte er an.
Gewiss, da ist ein Jahrhunderte altes Fundament. Ich entstamme einer welfischen Familie, die etwa seit 300 Jahren in Göttingen lebt. Meine Großmutter dort war – wie wir alle im Clan – evangelisch. Sie riet mir einst, ich solle, einmal ins Alter gekommen, am besten eine evangelische Frau heiraten, um meine Identität leichter zu wahren – und wenn nicht, besser eine Jüdin als eine Katholikin; denn wie man wisse, „lügen alle Katholiken“, sprach Großmama und dachte wohl an eine schlesische Putzfrau in ihrem Haus.
In meinen fünf Jahren in Polen traf ich dann aber so viele nicht lügende Katholiken, dass diese Göttinger Beigabe ziemlich rasch zu einem Bonmot verblasste, das heute nur noch darüber Auskunft gibt, dass einst im Welfenland der Anti-Katholizismus kaum weniger verbreitet war als der Antisemitismus.
Andrzej Szczypiorski, der polnische Freund und Schriftsteller, entließ mich Jahre später mit der Feststellung aus Polen nach Israel, „Israelis sind nicht weniger kompliziert als wir Polen. Da wirst Du Dich wohl fühlen, damit kannst Du umgehen.“ Damit hatte der Autor der „schönen Frau Seideman“ recht. Meine Familie und ich haben uns in den 18 Jahren in Israel, in Jerusalem wohlgefühlt. Und diese Jahre haben natürlich auch noch mehr geprägt als die Zeit in Polen; und nicht nur in Bezug auf den Glauben.
In Israel lernte ich, dass man sich zu seinem Glauben bekennt, gerade wenn das nicht ohne Risiko geschieht. Unser Propst in Jerusalem hat es mehrfach erlebt, dass ein Muslim oder ein ultraorthodoxer Jude verächtlich auf sein Kreuz um den Hals guckt und vor ihm ausspuckt. Im Pilgerhaus der Benediktiner von Tabgha legten ultraorthodoxe, jugendliche Juden aus Christen-Hass ein Feuer. Mich selber bediente einmal in Bethlehem eine Muslima in ihrem Geschäft nicht, weil sie mein Johanniterkreuz auf dem Polo-Shirt sah, wie mir ein junger Mann berichtete, der kurz nach dem vergeblichen Besuch in dem Lädchen hinter mir hereilte.
So – wenn auch nur oberflächlich bedrängt, könnte man doch in unserem deutschen Bequemlichkeitsdenken annehmen, dass ein Christ in Jerusalem oder Bethlehem sein Kreuz lieber nicht zeigt. Tatsächlich aber ist es genau andersherum: Gerade weil Religionszugehörigkeit auch ein Teil der sozialen Identität ist, die gleichermaßen mit bedroht ist wie die religiöse Identität, nimmt zB laut Statistik die Neigung vieler Christen im Heiligen Land zu, sich das Christen-Kreuz sogar auf den Handrücken oder den Unterarm tätowieren zu lassen. In der Not zeigt seinen Glauben erst recht.
Schon von den Kirchenvätern wissen wir, dass das Christentum in seinen ersten Jahrhunderten eine Religion des Martyriums gewesen ist. Die Christenverfolgungen begannen mit Nero 64 n.Chr. und endeten erst mit Konstantin im vierten Jahrhundert.
Im Jahre 112 fragt der jüngere Plinius, (das ist der Neffe es Alten, der beim Ausbruch des Vesuvs 79 ums Leben gekommen war) also Plinius der Jüngere, frisch als Gesandter in „Bithynien und Pontus“ am Schwarzen Meer angekommen in einem Brief an Kaiser Trajan, wie er denn mit der zunehmenden „Seuche des Aberglaubens“ bei den sog. Christen umgehen sollte. Er habe bisher keine Ahnung wie man mit diesen unangenehmen Leuten, die zum Sonnenaufgang auf den Plätzen irgendwelche Lieder sängen und beteten, verfahren solle. Deren Zahl nehme ständig zu, es gebe sie nicht nur in den Städten, sondern auch „über Dörfer und Felder verteilt“. Aus dem Zusammenhang im Brief ergibt sich, dass viele nun festgenommene Christen schon 20 Jahre zuvor einmal als Bekenner festgenommen aber nicht getötet, sondern wieder freigelassen worden waren; ob die wohl gelogen hätten, um damals dem Tod zu entgehen? Und jetzt? Wie solle er verfahren, damit sich diese Menschen wenigstens jetzt endgültig von diesem „abscheulichen Aberglauben“ lösten, fragt Plinius den Kaiser und es schwingt dabei die Feststellung mit, dass das Töten der Christen allein bisher den Aberglauben nicht habe ausrotten können.
In diesem Zusammenhang fallen mir die aktuellen Statistiken zur Christenverfolgung weltweit ein. Danach ist das Christentum die am meisten verfolgte Religion. Aber gerade da, wo Christen verfolgt werden, weichen sie auch heute – so wie unter Plinius (dem Jüngeren) – nicht aus. Unter dem Druck der Islamisten nehmen sie viel mehr zu. Immer wieder gibt es neue Märtyrer, so wie die „21 Kopten“, die von Islamisten an der libyschen Küste ermordet wurden.
Der katholische Schriftsteller Martin Mosebach machte aus der Beschreibung ihrer selbst und ihrer Familien 2015 einen Bestseller. In dem Buch wird deutlich, dass sich diese Menschen mit dem Tod abfinden konnten, weil sie ihn nicht fürchteten. Diese Märtyrer empfanden das Kreuzes-Tattoo, das sie enttarnt hatte, geradezu als Mittel zum Überleben nach dem Tod. Es hatte ihren Leben für das Nachleben einen Sinn gegeben.
In einem schönen Aufsatz für die NZZ beklagte dieser Tage der schweizerische Schriftsteller Thomas Hürlimann die Neigung in der Schweiz oder in Deutschland, Kreuze abzuhängen. Er schrieb: „Der Glaube, mit dem Abhängen der Kreuze lasse sich der Tod abhängen, ist ein fataler Irrtum. Nein, den Tod hängen wir nicht ab, auf den laufen wir zu, und genau aus diesem Grund, weil der Tod gewiss ist, sollten wir das Kreuz als Hoffnungs- und Überlebenszeichen stehen lassen. Denn es stellt den Lebensbaum dar, den vielblättrigen und vielfruchtigen, den immerwährend verwelkenden und aufblühenden, und wer dieses Symbol eliminiert, der verleugnet damit nicht nur seine Abstammung aus dem Abendland, er sägt auch die Äste ab, auf denen wir hocken.“ Im Nahen Osten ist man klüger; da weiß man das ohne Hürlimann.
Noch etwas bringe ich zum Kreuz als Jerusalemer Prägung mit: Das Malteser-Geburtskrankenhaus von Bethlehem hat vor allem muslimische Gebärende auf seinen Stationen und deren Familien. Aber das sei für den Orden keineswegs ein Grund, das achtspitzige Kreuz abzunehmen, sagte mir einmal der damalige Hospitalier und heutige Großkanzler des Ordens, Albrecht von Boeselager. „Das wird auch von uns Maltesern nicht verlangt. Es gebe auch andere Plätze in den palästinensischen Gebieten, wo man Kinder gebären kann. Aber die Muslime kommen zu unserem Kreuz“, erklärte mir Boeselager.
Ich verliere nicht den Faden, wenn ich noch eine weitere Anekdote anhänge: Bei einer interreligiösen Konferenz in Amman, zu der mich der damalige Kronprinz Hassan eingeladen hatte, saß sich bei einem Essen neben einem muslimischen Würdenträger, einem Imam. Wir redeten über die Liberalisierung in westlichen Gesellschaften und über die Toleranz in christlichen Ländern. Irgendwie witterte ich, dass ich nun Bekenntnis zeigen müsste, und erklärte mich als Johanniter und Mitglied der evangelischen Gemeinde in Jerusalem. „Oh“, sagte der Imam da. „Das höre ich gerne. Mit Ihnen kann man sich unterhalten; denn Sie stehen für etwas. Für viele Muslime verbirgt sich nämlich hinter Begriffen von Säkularisierung, Toleranz und Liberalisierung nur Leere. Die Lehre von einer vermeintlichen Bekenntnisfreiheit erscheint uns Muslime geradezu als Mangel an Identität und wirkt wie die Einladung, dies Vakuum mit Islam zu füllen.“
Das ist eine dieser Lehren, die ich aus Jerusalem mitgebracht habe. Es beeindruckt keinen Muslim, wenn man ihm mit beliebig säkularem Nichts entgegenkommt oder mit der vorauseilenden Annahme, man solle lieber alle Kreuze abhängen, Schweinefleisch verbieten und womöglich auch noch ein bisschen Scharia zulassen, weil dies Rechtssystem des Islam ja nun einmal zur Identität eines Muslims und der Muslima gehörten. In einer christlich geprägten Gesellschaft gehört das Kreuz nun einmal dazu; aber es muss freilich auch bekannt werden.
Schon Jeremias hatte schließlich nicht verlangt, man solle seine Identität nach den neuen Nachbarn ausrichten. Er hatte vielmehr gefordert, sich mit der ererbten Identität und mit dem Bekenntnis zur Religion der Väter einzubringen.
Ich muss nun gleich bekennen, dass ich kein guter Bekenner, oder Protestant bin; ich darf Sie dabei daran erinnern, dass das Verb protestare wenig mit Protest zu tun hat. Der Begriff meint vielmehr: in aller Festigkeit und offen bekennen. Katholiken meinen ja immer, wir würden nur gegen den Katholizismus protestieren wollen, stattdessen ruft Martin Luther Evangelische dazu auf, ein klares Bekenntnis im Glauben abzulegen. Und das gilt natürlich auch für Katholiken.
Ich bin dabei leider nicht besonders gut: Zu den jeweiligen Konfirmationen unserer Kinder in Jerusalem schenkte ihnen ein griechisch-orthodoxes palästinensisches Ehepaar, unsere besten Freunde dort, ein goldenes Kreuzchen, das die Kiddis um den Hals tragen sollten. Diese Familie verlangte von uns kein Tattoo, – aber schon das Halskettchen lehnten wir als spießig ab.
Und damit wären wir mitten in unserer Gesellschaft. Wohl wenige von uns hier in diesem christlich konservativen Freundeskreis tragen das Kreuz; schlimmer noch, wenn es im Durchschnitt der Gesellschaft getragen wird – dann gerne als reines Schmuck-Element ohne geistigen Inhalt. Hammer und Sichel sind dagegen gerade nicht so in.
Aber weiter: Nach 18 Jahren Jerusalem kamen wir nach Rom. Mehr als zehn Jahre haben wir dort nun eine feste Adresse; und Sie könnten annehmen, dass dieses lange Verweilen dazu geführt hätte, dass die schlimmsten Befürchtungen meiner Großmutter wahr geworden wäre und wir – meine evangelische Frau und ich – katholisch wurden. Tatsächlich hat sich bei mir das Luthertum noch einmal gefestigt. Heute würde ich sogar sagen, Martin Luther hat versucht, seine Kirche endlich wieder katholisch zu machen; „denn Luther war katholischer als die Kirche seiner Zeit“. So schreibt es auch Prof. Wolfgang Thönissen, der Kirchenhistoriker, Theologe und Leiter des „Instituts für Ökumenik“ in Paderborn in dem besagten Buch vom „Kelch für zwei“.
Bissiger noch drückte es der Ordensdekan unseres Johanniterordens Christoph Markschies aus, als dieser einzige evangelische Theologe mit der Berechtigung Vorlesungen an der päpstlichen Augustiner-Universität in Rom zu halten – in seiner Antrittsvorlesung davon sprach, dass die Lutheraner die eigentlichen Katholiken seien. Der augustinische Bettelmönch habe schließlich nie eine eigene Kirche gründen wollen. Hätten die Kardinäle seinerzeit Luthers Lehre gelesen und verstanden, dann hätte ihnen auffallen müssen, dass Luther katholischer war und ganz dem Gründer seines Ordens, dem heiligen Augustin, verbunden. Die Augustiner der besagten Augustiner- Universität feierten Markschies übrigens, so als habe er ihnen endlich ihren Augustinerbruder Luther zurückgebracht.
So will ich auch keineswegs, ökumenisch beseelt, einen Graben zwischen evangelischen und katholischen Christen treiben. Aber uns fällt in Rom immer wieder auf, dass doch dieses Weltzentrum der katholischen Kirche ein besonders säkularer Platz ist, in der man zwar in die Kirche geht, aber nur als Usance und nicht zum Bekenntnis. Unser Nachbar im Palast am Platz, ein Fürst Aldobrandini-Borghese, pflegt sogar zu sagen, er gehe nur noch zu Beerdigungen in die Kirche. Diese katholische Kirche gebe ihm rein gar nichts, sagt der Anglist und mehrfache Urur-Neffe von Papst Clemens VIII., einem Gelehrten, der die katholische Kirche nach dem Konzil von Trient vergeblich reformieren wollte.
Der Katholizismus in Rom ist so selbstverständlich, dass er sich nicht irgendwelchen Fragen stellen mag. Ein normaler Römer kennt weder unsere evangelisch deutsche lutherische Kirche noch das lutherische Bekenntnis. Das ist ein Hauptproblem für jegliche Reform von Kirche heute. In der Stadt des Kirchenvolks ist Kirche kein Thema, aber auch in der italienisch geprägten Kurie will man vom selbstverständlich Gewordenen nicht abweichen. Johannes Paul II. und Benedikt XVI. setzten stets das Einverständnis der Katholiken und vor allem des Klerus´ mit Lehre und Tradition voraus.
Das Problem für Franziskus ist es nun, dass er in seiner Kirche auf Einsichten setzt. Jesuitisch geschult stellt er immer wieder neue Fragen, setzt auf die geistige Auseinandersetzung und das Erkennen und hofft dann auf gemeinsame Einsichten. Tatsächlich aber überfordert er bisher damit seine Kirche. Um es präziser zu fassen, Benedikt XVI. nahm mit seinem kritischen Verstand Theologie sehr ernst; er selber stellte sich der rationalen und philosophischen Auseinandersetzung mit Denkern wie Habermas; aber er setzte gleichzeitig in seiner Kirche auch das Einverständnis mit dem Dogma voraus.
Mir hat er einmal gesagt: „Ich hoffe, Sie werden in Rom nicht zum Katholiken; denn wir brauchen Lutheraner zur Auseinandersetzung um den richtigen Weg zu Gott.“ Damit ließ er mit einem Mitglied einer anderen Konfession die Auseinandersetzung zu. Franziskus aber will sie in seiner eigenen Kirche. Das sehen wir allein schon in dem offenen Umgang, den er weit über den üblichen Kreis seines Klerus` bis in evangelikale Gruppen hinein pflegt.
In diesem Zusammenhang wird Franziskus vorgeworfen, er sei ein „Meister dabei, theologische Kontexte unter den Tisch fallen zu lassen.“ In scherten „kirchenrechtlich eindeutige Formulierungen nicht“. Wenn er sich zum Beispiel in die Vorstellung versteigere, das gemeinsame Abendmahl zu propagieren, dann bügle er einfach die „Verschiedenheiten im theologischen Denken“ platt. Konservativen Katholiken gilt er längst als Häretiker.
Um es theologisch auszudrücken: der überaus fromme Franziskus fordert den Heiligen Geist für mehr Ökumene heraus; während Benedikt XVI. meinte, der Heilige Geist werde schon für mehr Einheit in der Kirche sorgen.
Sie wissen wohl alle, dass Papst Franziskus der evangelischen Christusgemeinde im November 2015 bei einer Vesper in unserer Kirche einen Abendmahlskelch mit Patene schenkte. Zugleich legte er einem katholisch-evangelischen Ehepaar nahe, nach gemeinsamer Gewissensprüfung die Eucharistie auch gemeinsam zu empfangen; vorausgesetzt sie seien geeint nach Paulus: ein Herr, ein Glaube, eine Taufe (Epheser 4,5). „Wenn das so ist“, sagte der Papst, „fragt Ihn (Gott) und geht voran“.
Noch Jahre später, als der damals gastgebende Pastor Jens-Martin Kruse, jetzt Hauptpastor von St Jakobi in HH, zu seinem Abschied eigens zu einer persönlichen Audienz vom Papst empfangen wurde, bat ihn Franziskus, auf diesem Weg weiterzugehen. Er solle die gemeinsame Eucharistie als einen Zwischenstopp auf dem Weg zu mehr Einheit sehen. Die Vesper war 2015. Seither ist viel zu wenig geschehen.
Ich sagte es ja schon; es steht schlecht um die Ökumene. Und ich habe jetzt auch die beiden Gründe dafür genannt, aber möchte sie zum Abschluss meiner Rede zusammenfassen:
Erstens: Papst Franziskus hat heute brennendere Probleme in seiner Kirche als diese Ökumene. Bedrängt durch Missbrauch, Amtsmissbrauch und Klerikalismus hat diese Kirche so viele große Feuer zu löschen, dass das gemeinsame Abendmahl und andere Themen der Ökumene als peripheres Flämmchen erscheinen. Im Weiteren macht die katholische Kirche einen Prozess der Differenzierungsprozesse durch, wobei die katholische Weltkirche in Afrika und Asien, wo Kirche wächst, kaum mehr etwas Kirche in Westeuropa zu tun hat. Während sich die deutschen Katholiken auf einen leider verkrampften „synodalen Weg“ begeben, ist die katholische Kirche in Polen eine Institution der Volksverdummung geworden. Nur in Westeuropa spielen Protestanten eine große Rolle, schon in Südeuropa – gibt es sie nicht. Franziskus muss aber seinen auseinanderdriftenden Haufen zusammenhalten; und das ist immens schwierig.
In Deutschland muss Kirche derzeit um ihre Glaubwürdigkeit ringen und erscheint keineswegs mehr als selbstverständlicher Partner gesellschaftlichen Lebens. Als Steuerberaterin sieht meine Frau vorrangig Steuererklärungen, in denen die Kirchensteuer nicht mehr gezahlt wird. Hochzeiten in der Kirche scheint es gerade noch im Gelben Kreis zu geben.
Der zweite Grund, warum es so schlecht um die Ökumene bestellt ist; zerfällt aus meiner Sicht in zwei Teile. A. Es gibt gute theologische Gründe für mehr Gemeinsamkeit, ich sprach ja schon von meinem Buch „ein Kelch für Zwei“; aber die Debatte darüber findet kaum statt. Katholische und evangelische Gemeinden machen einfach viel gemeinsam, weil es bequemer ist, weil man die Mittel bündeln will, weil die Unterschiede nicht mehr gesehen oder nicht mehr ernstgenommen werden. (Das aber schafft – dies am Rande – keinen Frieden in den Kirchen; denn natürlich gibt es auch weniger offene Priester und Gläubige, die sich dann mit guten Gründen in den Weg stellen. Gerade die müssten theologisch überzeugt werden.) Vor allem will ich sagen, dass es so schlecht um die Ökumene gestellt ist, weil sie nicht als Gottesgeschenk, sondern als eine praktische Maßnahme der Nettigkeit angesehen wird.
Beim B. komme ich wieder zu Jeremias und dem Kreuz zurück. Der Ökumene geht es mE auch deswegen so schlecht, weil uns ganz allmählich der Grund für Glauben und Hoffen, das Bedürfnis nach Christsein und das Wissen von der Befreiung von aller Not durch das Kreuz abhandenkommt. Das Kreuz? Welches Kreuz?
Das Kreuz, das Teil unserer christlich abendländischen Prägung ist. Es liegt auch in den Koffern, von denen bei Jeremias die Rede ist, denn es ein Teil unserer Identität. Diese Prägung bringen wir wie ein Erbe – einen genetischen Code – ein und sollten ihn auch bekennen, wenn wir mit dem Fremden sprechen und für uns wie für ihn der Aufforderung des Propheten Jeremias` folgen, nach „der Stadt Bestes“ zu suchen.
Vielen ist es egal, dass sie als Christ geboren sind; und wenn sie darauf angesprochen werden, dann schämen sie sich sogar und geben entschuldigend zu verstehen, dass das mit den Kreuzzügen der Christen im Mittelalter gegen die Muslime fürchterlich gewesen sei. Genauso schlimm sei der totale Krieg der Kolonialisten gegen schwarzafrikanische Völker gewesen. Zudem und vor allem habe die christliche Kirche auch in der Shoah versagt. Liebe Leute; das ist alles wahr! Und Martin Luther war auch ein Antisemit, Gewiss!
Tatsächlich aber steht das Christentum mit seinem Evangelium auch für einen Grundgedanken der Demokratie. Wir sprachen schon vom Philosophen Jürgen Habermas, der mit Kardinal Ratzinger 2004 in der katholischen Akademie Bayerns einen spannenden Dialog über Religion und Vernunft führte. Habermas weist uns darauf hin, dass die durch das Juden- und Christentum geprägte Ebenbildlichkeit des Menschen mit Gott zentral für den Erfolg für das Christentum gewesen sei, als plötzlich in den römischen Gesellschaften Sklaven und Herren gleichbehandelt werden sollten. Sie müssen sich das Entsetzen römischer Senatoren im zweiten und dritten Jahrhundert nach Christus vorstellen, als plötzlich ihre Ehefrauen – ich denke gerade an die Römerin Paula aus dem ehrwürdigen Stamm der Gracchen – begannen, Sklavinnen wie Menschen zu behandeln. Pfui Deibel!
Von der Idee des Evangeliums lebt die Französische Revolution mit ihrer Forderung nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Wenn denn alle Menschen vor Gott gleich sind, dann müssen sie auch untereinander im Respekt um diese Ebenbürtigkeit umgehen: Mann und Frau gleich vor Gott, one man, one vote. Ich möchte diesen Gedanken jetzt – schon aus Zeitmangel – nicht weiter vertiefen. Aber einen Begriff wie Nächstenliebe kennt keine andere Religion. Christliche Nächstenliebe hat UN-Status.
Wenn wir Christen, auch wir aus dem Gelben Kreis, also etwas einbringen können, dann sind es diese Werte, die sich zugleich mit Toleranz und Offenheit aus Respekt vor der Andersartigkeit verbinden, die sich in der Ebenbildlichkeit vor dem unerklärlichen alles bergenden Gott aufhebt.
Tatsächlich aber können wir diese Toleranz, diese unerträgliche Spannung zwischen Selbst- und Nächstenliebe nur leben und ertragen, wenn wir uns dadurch gerechtfertigt und beglückt sehen. Es ist einfach leichter, einem Vorbild zu folgen. Manche finden ja Fußballer wie Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo großartig. Wenn ich, zugegeben zaghaft, an ein Vorbild oder eine Richtschnur denke; dann ist es mehr Jesus Christus am Kreuz. Aber ich fühle mich manchmal ziemlich allein.
Ich glaube mithin schließlich: Es ist um die Ökumene bei uns und in der Welt so schlecht bestellt, weil uns der Glaube und das Kreuz abhandenkommen. Dabei ist dieses Kreuz, vor dem einige übellaunige ultraorthodoxe Jude und Islamisten wie gesagt auf die Straße ausspucken, das starke Symbol für Demokratie und Gerechtigkeit auf Erden sowie der Hoffnung auf Rechtfertigung im Tod.
Ein letztes Mal zurück zu Jeremias: Der riet seinen jüdischen Mitgläubigen, die Koffer auszupacken und dass Ihre zum Besten der Stadt beizutragen. Was also können wir heute beitragen zum Besten der Stadt, wenn nicht unsere christlich-jüdische Identität. Was wir sonst anbieten könnten? Wenig! Wir müssen uns jedenfalls nicht wundern, wenn Muslime – jener Imam sagte es schon – unsere Leere für ihren Islam nutzen; oder wenn Populisten von rechts und links mit billigen Angeboten und leichten Antworten versuchen, unsere reichlich mit guten Traditionen gefüllten Koffer bloß nicht zu öffnen. Wenn wir die wichtigen zentralen Nachrichten vom Kreuz und seinem Segen nicht aus unseren Koffern holen, dann haben fake news high time.
Also, ihr lieben Gelben: Das ist meine Botschaft, Mission, mein Bekenntnis nach Jahrzehnten im Ausland. Öffnet eure Koffer mit den guten Stoffen der christlich-abendländischen Tradition. Steht zu dem ererbten Kreuz da drin, das nicht nur an Jesu Tod erinnert, sondern auch an seine Auferstehung. Vergesst nicht die symbolische Kraft jenes Holzkreuzes, jenes Stammes – aus dem im Boden wieder neues Leben wird; das zum Lebensbaum wird und zum Urstrom aller Wasser, wie uns so viele Mosaiken in den Kirchen der Väter vor Augen führen. Eure Familienstämme wurzeln in diesem Erbe und leben aus dieser Kraft, ihr auch. Das ist christlich-konservativ.
Wenn wir also nach der Stadt Bestem suchen, dann sollten wir dies Erbe vom Kreuz des Todes und des Lebens selbstbewusst aus unseren Koffern holen, auspacken und – bekennen. (jöb)