Ist denn überhaupt noch etwas lebendig von der alten Pracht? Leben zum Beispiel die Nachfahren der alten Familien weiter in Palästen? Oder gibt es dort nur noch Büros, Banken und Hotels? Tatsächlich wurden die Stadtpaläste von Generation zu Generation weitergegeben. Noch leben die Massimos, wie gesagt, am Corso Vittorio Emmanuele II., die Prinzessin Borghese im Palazzo Borghese. Die Doria Pamphilj, Odescalchi sowie die uralten Clans der Orsini und Colonna residieren in angestammten Häusern. Die Aldobrandinis, bekannt für ihr Schloss in Frascati, haben mitten im Zentrum weiter ihren alten Sitz. Wir sind Nachbarn, kennen uns, laden uns bisweilen ein. Der „schwarze“, historisch mit dem Papst verbundene Adel, der dem Zentrum sein Gesicht gab, spiele heute in Rom keine Rolle mehr, sagt Giovanni bei einem Spaziergang durch die Altstadt. „Aber als Eigentümer großer Immobilien und Vermieter leisten sich Familien wie meine eine gewisse Unabhängigkeit; sie sind wohlhabender als zum Beispiel die alten Familien in Neapel oder auf Sizilien“, fügt er hinzu. Der Anglist und Historiker, Vater zweier Söhne, trägt denselben Vornamen wie jener Kardinal Giovanni Aldobrandini, der als erster seiner Florentiner Familie nach Rom kam und 1573 in der Grabkapelle der Familie in Santa Maria sopra Minerva beigesetzt wurde, der Kirche mit Berninis Elefanten vor dem Portal. Dort werden bis heute die Namensträger beigesetzt, „auch Agnostiker wie ich dereinst“, lacht Giovanni. 1638 starb die Familie im Mannesstamm aus. Aber über eine Ehefrau wurde er weitergegeben, und so heißt heute eine Linie der Fürsten Borghese Aldobrandini. Der jüngere Bruder jenes Giovanni Aldobrandini, Ippolito, schaffte es als Clemens VIII. auf den Petersthron. Er soll bescheiden und fromm gewesen sein, gilt als Reformpapst, aber für die Reformation trat er nicht ein. Vielmehr stärkte Clemens VIII. die Jesuiten im Kampf gegen die für das machtbewusste Papsttum so lästige, da rein katholische Lehre Luthers und ließ jenen Giordano Bruno, der freilich mehr ein Freigeist und auch kein frommer Lutheraner war, wegen Häresie auf dem Campo de` Fiori verbrennen.
Wahrscheinlich liege es schon an dieser Nähe zum Papsttum, dass der kirchentreue Adel von Rom nach der Auslöschung des Vatikanstaats 1870 und der Regierungsübernahme durch die Monarchie der Savoyer aus Turin zunächst keine und dann kaum mehr eine politische Rolle spielte, sagt Giovanni weiter. Zunächst verboten die Päpste auch jedes politische Engagement im verhassten laizistischen Königreich. Erst 1904 ließ Pius X. die Abstimmung von Katholiken zu, vorausgesetzt damit könnten Wahlsiege der Sozialisten verhindert werden. Wer die Sozialisten wählte, musste mit Exkommunikation rechnen. Ein Ahn von Ex-Ministerpräsident Paolo Gentiloni setzte 1913 bei Pius X. die Wahlhilfe seiner „Katholischen Wähler Union“ für die Koalition des liberalen Ministerpräsidenten Giovanni Giolitti durch. Das war Graf Ottorino Gentiloni, und wenn auch die Gentilonis aus den Marken stammen, so galten sie damals schon als römische Familie, „und die ist mit ihrem Engagement in der Politik eine Ausnahme“, erzählt Giovanni. – Ich habe mit Regierungschef Paolo Gentiloni in seiner Amtszeit (2016 von 2018) mehrere Gespräche geführt und war von seiner umfassenden Kenntnis der Problemlage, seiner Ruhe und Gelassenheit beeindruckt; seine zurückhaltende und bescheidene Auftrittsweise sind für den späteren EU-Kommissar für Wirtschaft und Währung in Brüssel ein Markenzeichen. – Nach dem Pakt von Pius XI. mit Mussolini durch die Lateranverträge 1929 hätten sich viele Adelige „auf diese ohne jene Weise“ als Faschisten hervorgetan, setzt Giovanni fort. Ausnahme sei Prinz Filippo Andrea Doria Pamphilj gewesen, das letzte Beispiel für politisches Engagement im jüngeren Italien. Prinz Filippo war der erste nach dem Weltkrieg gewählte Bürgermeister von Rom und der letzte im Königreich Italien, aber nur kurz von 1944 bis 1946 im Amt.
Die Kirche schaffe Kontinuität, sagt Giovanni. Sie sorge womöglich auch für so etwas wie einen „ewigen Charakter der Stadt“, obwohl sich die Kirchenväter nach der Zerstörung Roms 410 lieber mit dem ewigen Reich Gottes befasst hätten. Mit dem „ewigen Rom“ Vergils und dem römischen Reich habe die Kirche jedenfalls nie etwas zu tun gehabt, auch wenn sie sich für ihre Legitimation geschickt bei der Reichshistorie bedient und diese für ihren Gestus und die Architektur genutzt habe, erzählt der Principe, während wir auf den Stufen vor dem Museum für den Friedenstempel des Augustus, Ara Pacis, rasten. Im Mittelalter habe die Kirche den alten Baronalfamilien der Stadt gehört – den Orsini, Colonna oder Caetani. Dass das Papsttum nach etwa sieben Jahrzehnten und sieben Päpsten im französischen Avignon mit Martin V. (Colonna) 1420 wieder seinen Sitz in Rom einnahm, womit in der Stadt die Renaissance begann, habe weniger mit Rom zu tun gehabt – da seien die Verhältnisse weiterhin unstabil gewesen –, wohl aber mit den europäischen Mächten, die das Papsttum nicht länger dem französischen König überlassen wollten. Mit dem neuen Aufstieg des Papsttums begann der Machtverfall der Kommune. Städtische Ämter übernahmen Kuriale. Die alten Familien wurden päpstliche Höflinge.
In Rom habe es trotz aller Reformbewegungen von England bis Böhmen nie einen Bruch im Glauben gegeben, erzählt Giovanni weiter. Die Reformation habe am Tiber keine Chance gehabt. Der aus Utrecht stammende Papst Hadrian VI. wäre wohl der einzige gewesen, der sich für Luthers an Augustin orientierten Katholizismus geöffnet hätte. Doch Hadrian, jener letzte Nicht-Italiener auf dem Papstthron vor Johannes Paul II., starb 1523 nach nur gut einem Jahr im Amt. „Nach ihm wurde dieser Aldobrandini Papst“, sagt Giovanni Aldobrandini in leichter Distanz zu seinem Ahnherrn. Die Reformation hatte freilich für die Italiener und Römer einen Vorteil. Britische, skandinavische oder deutsche Priester drängten nicht mehr so stark wie zuvor nach Rom. Vakante Ämter wurden wieder von Ortskräften übernommen; das Papsttum wurde wieder italienisch. Noch immer sähen sich die meisten Römer als Katholiken. „Aber sie folgen vor allem einem gesellschaftlichen Brauch; während die Kirche wegen Missbrauch und Klerikalismus schwächer wird.“ Durch die drei ausländischen Päpste – einem Polen, dem Deutschen und diesem Südamerikaner – sei die Kirche auch wieder deutlich internationaler geworden. „Die Kirche wird endlich wieder durch die Welt geprägt, zum Leidwesen vieler Italiener in der Kurie,“ die die Kirche am liebsten weiter für sich besitzen würden.
Wenn also der städtische Adel und die Kirche Rom nicht mehr mit schönen Gebäuden schmückten, wer präge die Stadt denn dann heute?, frage ich Giovanni. In Turin stoße man immer wieder auf die Fiat-Familie Agnelli als Wohltäter, in Venedig wirkten Dogen-Familien weiter als Mäzene für Museen oder die Universität. Das aber gäbe es in Rom nicht. Nur eine frische Ausnahme fällt ihm ein: Die jüngste Generation der Fürsten Torlonia, die bisher ihre Reichtümer in ihren privaten Palästen, Villen und vor allem in einem riesigen Lager am Tiber versteckt hielten, wollen ein öffentliches Museum einrichten und zeigten dazu im Vorhinein – leider mitten in Corona-Zeiten – im Palazzo Caffarelli auf dem Kapitol einen Mini-Teil ihrer Antiken. Vielleicht erschien die Präsentation der Stücke wahllos, aber der Platz dieser Ausstellung hatte gerade für Deutsche besonderen Reiz.
Einst residierte nämlich in diesem Palast Caffarelli – über den Ruinen des Jupiter-Tempels – die preußische Gesandtschaft beim Vatikan. In ihrer „Gesandtschaftskapelle“ konnten Protestanten unter diplomatischem Schutz vor päpstlicher Polizei Gottesdienst feiern, bis sie nach der Auflösung des Kirchenstaats 1870 eine eigene Kirche in der Via Sicilia zu bauen begannen. Zur Empörung der Römer hatte Kaiser Wilhelm II. in dem Saal über jener Kapelle einen festen Thron installieren lassen. Nachdem Italien im Mai 1915 gegen Berlin und Wien in den Krieg eintrat, mussten die Deutschen Caffarelli räumen; der Thron wurde abgebaut und nach Berlin geschafft. Die Römer taten ein Übriges: Sie rasierten den Thronsaal ab, ein ganzes Geschoss des Palastes musste im Hass auf die deutsche Anmaßung fallen. Heute befindet sich dort die Café-Terrasse des Kapitolinischen Museums, so dass nichts mehr an diesen preußischen Frevel an Jupiter erinnert. Bis zur Torlonia-Ausstellung war die Gesandtschaftskapelle nicht mehr zu sehen gewesen. Nun aber ließ sich diese Halle wieder besuchen. Drei Rundungen in der Wand, vor der einst der Altar stand, erinnern an die Mosaiken von Jesus Christus, Petrus und Paulus, die heute in der Christuskirche hängen, einst aber eben hier in der Kapelle. Das zu den Fürsten Torlonia.
Ein anderes Fürstenhaus öffnet einmal im Jahr, an jedem 16. März, den Palazzo alle Colonne. Das ist dann für die feine Gesellschaft Roms eine Messe wert. Die Massimo zählen sich zu den ältesten Häusern der Stadt und wollen sich auf einen Namensträger zurückführen, der um 950 in Rom lebte, wenn nicht auf den Senator Quintus Fabius Maximus Verrucosus, der wohl 203 v. Chr. starb. Als wir einmal den Hausherrn danach fragen, wartet er mit einer Anekdote auf, die freilich überall kolportiert wird: Kaiser Napoleon I. habe seinen Vorfahren einmal gefragt, ob denn das mit den etwa 2000 Jahren Familiengeschichte stimme. Darauf habe jener Fürst Massimo dem Kaiser geantwortet: Dies Gerücht hält sich „in unserer Familie seit 2000 Jahren hartnäckig”. Geraune und Gelächter! Dabei dürfte selbst die familiäre Vereinnahmung der beiden heiligen Päpste Anastasius I. (gestorben 401) und Paschalis I. (824) zum Massimo-Clan mythischer Natur sein. Die Stammreihe beginnt wohl erst mit Leone Massimo, der 1012 starb. Oder noch nicht einmal das?
Dem deutsch-römischen Historiker Arnold Esch zufolge tauchen die Massimo erst gegen 1400 aus dem Nebel der Geschichte auf, und zwar als Gewürzhändler. Das sei freilich ein guter Anfang gewesen, schreibt der Kenner der römischen Quellen- und Stadtgeschichte. Diese Handelsleute handelten auch mit Medikamenten, Rauschgiften und Mineralien und verkauften diese Waren natürlich am liebsten an den päpstlichen Hof. Das war dann schon was! Als bei einigem Erfolg und Jahrzehnte später nicht mehr die gesamte Familie im Laden schuften musste, konnten Massimo-Söhne für den weiteren sozialen Aufstieg studieren, in wichtigen Bruderschaften aktiv oder ins Kapitel großer Kirchen (mit Bezügen!) gewählt werden, und schließlich konnten sie sich schließlich einen stattlichen Sitz in der Stadt leisten, Land vor der Stadt kaufen und in altadelige Familien einheiraten, zu denen sie dann aus päpstlicher Gnade bald selber gehört haben dürften. (Arnold Esch, Rom – Vom Mittelalter zur Renaissance, 1378 – 1484. C.H.Beck, München 2016). Die Massimo finanzierten 1467 übrigens die ersten deutschen Buchdrucker in Rom und brachten so das neue Gewerbe nach Rom. Aber das tut hier nichts zu Sache.
Es soll vielmehr um den nur 14 Jahre alt gewordenen Prinz Paolo Massimo gehen, der am Vormittag des 16. März 1583 im Sterben lag. Eigentlich besuchte – der später heiliggesprochene – Filippo Neri an jedem Morgen den Jungen, aber an diesem Tag kam er zu spät. Paolo war schon tot. Da gelang es Neri nach der Legende, den Jungen mit seinem Namen nochmals wachzurufen und mit dem Wiedererweckten ein letztes Gespräch zu führen. Neri nahm Paolo überdies die Beichte ab und gab ihm die Sterbesakramente. Dann habe Paolo ihn gebeten, wieder sterben zu dürfen; im Paradies habe er nämlich schon seine Mutter und Schwester wiedergetroffen. Dieses Wunder wurde später unter Eid vom Vater Fabrizio und dem ebenfalls anwesenden späteren Kardinal Cesare Baronio bestätigt. Bekannt wurde diese Geschichte allerdings erst durch das Heiligsprechungsverfahren für Neri 1595. Noch später wurde das Sterbezimmer zur Kapelle umgebaut, und seit dem 19. Jahrhundert reiht sich am Todestag eine Messe für den Toten an die andere. Doch jeweils um 11:00 Uhr zelebriert ein Kardinal, und das ist dann der Anlass für Roms High Society, zur Messe zu kommen und den Massimos die Aufwartung zu machen. Für Trauer ist längst kein Anlass mehr, wohl aber für einen guten Mokka oder eine heiße Schokolade im Kreis der Geistlichen und der fürstlichen Familie nach der Messe. An diesem Tag schenken Kellner in barocken Uniformen die Getränke aus und servieren Tramezini.
Ein ständiger Treffpunkt für den päpstlichen Adel ist der Caccia Club im Palazzo Borghese. In diesem Jagdclub, in dem Kellner in grünen Nickerbockern bedienen, können nur Italiener Mitglied werden, die auf Vater- wie Mutterseite über mehrere Generationen hinweg adelig sind. In den barocken Hallen, dem grandiosen Hauptsaal oder in den exklusiven Räumen der Mitglieder trifft man den alles andere als adelsstolzen Giovanni Aldobrandini selten; aber andere Herren mit silbernen Schläfen und dunklem Anzug (der ist Vorschrift!) finden sich hier zu Mittag oder Abend ein, um bei einem guten Essen – mit oder ohne Damenbegleitung – auch ihre Standespolitik vorantreiben. So versuchten sie zum Beispiel 2017, im katholischen Malteserorden den jagdseligen aber bei den Maltesern überforderten Großmeister Fra` Mathew Festing dafür zu missbrauchen, den Chefhospitalier und dann Großkanzler Albrecht von Boeselager und andere Mitglieder der Ordensregierung loszuwerden, die es mit dem Ordensauftrag zu ernst nahmen. Reaktionäre, vor allem italienische und britische Ritter, dachten lieber an Posten und Ehren und taten zum Beispiel wenig, um ihr römisches Malteser-Krankenhaus in Magliana vor der Stadt von seinen quasi ewigen Schulden zu befreien, während sich Boeselager und andere allein auf die Sozialarbeit im „Dienst an den Herren Kranken“ konzentrieren wollten, für den der Johanniterorden um 1050 in Jerusalem schließlich gegründet worden war.
So wollte Boeselager Migranten helfen, die von Libyen über das Mittelmeer drängten, während seine italienische Confratres an Abschottung dachten. Mit dem Kritiker von Papst Franziskus, dem amerikanischen Kardinal Raymund Burke, sannen jene Herren lieber über einen Schlag gegen den Papst nach, als sich zum Beispiel dem päpstlichen Wunsch nach mehr Ökumene zu widmen. Als Festing dann Boeselager tatsächlich aus dem Orden geworfen hatte, schritt Papst Franziskus ein, setzte Boeselager wieder ein und warf dafür Festing aus dem eigentlich lebenslänglichen Amt – und der war darüber letztlich rührend erleichtert. (Constantin Magnis, Gefallene Ritter – Malteserorden und Vatikan, Harper Collins, Hamburg 2020.) Damit hatte sich erstmals seit Jahrhunderten ein Papst in die Laien-Personalpolitik des Ordens eingemischt, freilich erst, nachdem er selber von Festing als vermeintlicher Helfer missbraucht worden war. Beim Lunch im Caccia-Club ging es darüber hoch her. Der Streit um die Satzung des Ordens um die Macht der hochadelig alten, ledigen und vermeintlich in Armut lebenden Führungsgruppe des 1. Standes ging weiter. Im Spätsommer 2022 setzte sich dann diese italienische MalteserCaccialobby unter Kardinal Silvano MariaTomasi durch und quälte Papst Franzsikus offenbar so lange, dass er die Ordensregierung unter Boeselager absetzte und damit auch die Souveränität des Malteserordens schwer beschädigte.
Ich kann mich auch noch an ein Abendessen im Caccia Club erinnern, zu dem Albert Fürst von Thurn und Taxis im Namen seiner Mutter Gloria eingeladen hatte. Die Bitte auf Bütten enthielt die Tenue-Anweisung, zu der Vorstellung eines Buches im „Frack und mit Orden“ aufzutreten: abito scuro con decorazioni. Die Geistlichen aus der Kurie hatten es da nicht schwer. Die tragen ihre Amtstracht; auch die Vertreter der Häuser Thurn und Taxis, Orsini, Torlonia, Colonna, Borromeo oder Windisch-Graetz haben es leicht. Diese Fürsten haben ihre Hausorden, die sie zum Frack tragen, wie es ihnen behagt. Aber der Fürst R. war „nur“ mit einem päpstlichen Orden erschienen. Das fiel einem der noblen „Gentiluomini Seiner Heiligkeit“ des Papstes auf, der den alten Herrn am Stock quer durch den Saal zu sich zitierte. Dass dieser dem Fingerzeig des deutlich jüngeren Edelmannes folgte, wirkte schon sonderbar. Als der jüngere Fürst dann dem älteren auch noch vorwarf, es gehe nicht an, dass er die Ordensschärpe über der Frackweste trage, obwohl der Papst nicht anwesend sei, war das für R. eine offene Brüskierung.
Fürst R. erschrak und zitierte seinerseits seine wesentlich jüngere, wohl zweite Frau herbei, um ihr zu sagen, dass sie das mit dem Orden doch hätte wissen müssen. Fast empört, wenn auch mit einem schon halb geleerten Whisky-Glas in der Hand, meinte darauf der Gentiluomo zu dem Alten: „Wie soll denn diese da das wissen?“ Das dürfte ein Seitenhieb auf den Umstand gewesen sein, dass sich Fürst R. da nicht nur eine deutlich jüngere, sondern mutmaßlich auch eine nichtadelige Gemahlin zugelegt hatte. Die jedenfalls erblich und schwieg; während der Edelmann des Papstes edelmütig meinte: „Naja, das nächste Mal wirst Du das ja wissen.“ R. zog mit Stock und Junggattin ab, und mit dem letzten Schluck Whiskey kicherte der Edelmann seiner päpstlichen Heiligkeit mir zu: „Das hat man davon, wenn man aus einer Familie stammt, die nicht ihren eigenen Orden hat.“ Ein zweites Glas Whisky voller Zufriedenheit rundete diese Caccia-Szene ab. (jöb.)
Aus: “Rom und Jerusalem – Weder ewig noch heilig” – Private Betrachtungen zu zwei verwandtren Zentren der Welt
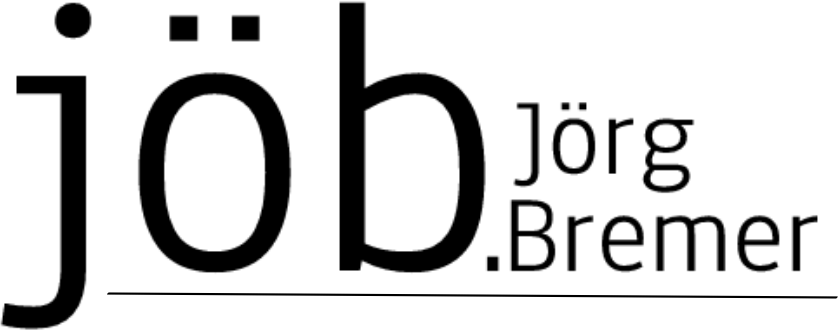
3 thoughts on “Von papstreuen oder agnostischen Fürsten, den Maltesern und dem Caccia-Club”
WVdTajJwNy
fFkUHCTgDIXV
aHdZJRGiwkCczh
Comments are closed.